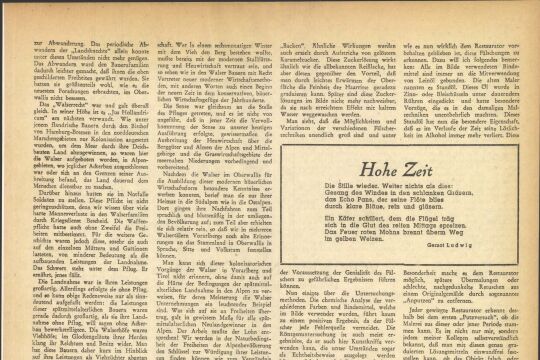Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Dichter des Leidens an Welt und Zeit
Theodor Storm. Sein Leben und seine Welt. Von Franz Stuckert. Carl-Schünemann-Verlag, Bremen. 507 Seiten.
Fontane hat einmal über Storms „Husumerei“ gespottet, denn das schien ihm etwas zu sein wie Heimat- und Idyllendichtung mit Stimmungszauber und Familienglück im Winkel, ein Sichergötzen am Allzukleinen und Begrenzten. Er dachte wohl an „Immensee“ und an die weichen und etwas knochenlosen Erzählungen der vierziger und fünfziger Jahre, an die Stormschen Resignationswellen und die Ent sagungslyrik. Der Spott war nicht ganz unberechtigt, und so blieb er an ihm hängen, wie Hebbels Spott an Stifter hängengeblieben war, obwohl aus dem spät- metternichschen Taschenbucherzähler der Wiener „Studien“ in Linz ein Prosaist von säkularem Ausmaß wurde, der „Nachsommer“ entstand und der „Witiko“. Stifter hat man dann wiederentdeckt, und während Hebbel langsam versank, stieg er auf. Aber Storm hat man (noch) nicht wiederentdeckt, und er ist geblieben, was er in den neunziger Jahren noch zu sein schien: ein postvormärzlicher Idylliker, ein begabter, aber stofflich begrenzter Erzähler, ein liebenswürdiger, aber nicht sehr belangreicher Novellist. Es half nicht viel, daß Hermann Hesse sich zu ihm bekannte, daß Thomas Mann sich tpit einem schönen Essay für ihn eingesetzt hat, daß andere von Ansehen und Urteilsfähigkeit den „Husumer" rühmten, denn man kam nicht über einen wohldosierten Respekt hinaus. Man nahm ihn eben nie ganz ernst und scheute auch davor zurück, ihn ernst zu nehmen, weil er der „Lieblingsdichter“ jener geworden war, die sonst nur „anonyme Literatur“ zu konsumieren pflegten, und weil gewisse Verleger es sich seit den zwanziger Jahren angelegen sein ließen, just das in Dutzenden von Ausgaben herauszubringen, was auf die mediokre Seite des Stormschen Werkes gehörte, was wirklich nur „Husumerei“ war oder bestenfalls der gefühlvollen Unterhaltung dienen konnte.
Kein Wunder, daß man sagte: Seine Welt ist seine Welt gewesen und hat mit unserer Welt nichts mehr zu tun; er lebte vor hundert Jahren! Gewiß, es war eine Welt der wohltemperierten Bürgertugend. Es wurde geliebt und entsagt, aber weder unter noch über den Stand geheiratet, und die Familie war das Höchste, was es gab. Man hatte im Gleichgewicht zu bleiben und den Gefahren auszuweichen, sein Leben hach Bürgerbegriffen ehrbar und anständig hinzubringen, fleißig zu sein und Konventionen und Traditionen zu pflegen. Man kann auch nicht bestreiten, daß das eine Welt fast ängstlicher Harmonisierungsversuche war und daß man mit Storm immer wieder in Biedermeiers Garten spazieren gehen mußte.
Es wäre noch manches von der Art zu sagen. Aber wir meinen, man sollte nun endlich nicht mehr übersehen, daß es Storm um etwas anderes gegangen war als um die Tröstung der aus ihren Träumen Aufgescheuchten, die nie wissen wollten, was die Zeit geschlagen hatte; denn er wußte nur zu gut, wie spät es war, und wenn man ihn unter dis Tröster und Beschwichtiger stellt, dann mißversteht man ihn. In seine Novellen brechen nämlich schon in den sechziger Jahren jene hereditären Dinge ein, die das Familiengefüge zerstören, und seine Familien- und Bürgerwelt ist schon von Gefahren umwittert. Einzelne, Einsamgewordene gehen in den Tod, Sippen werden durch Geiz und Starrsinn zugrunde gerichtet, und das Glück im Winkel hat keiner mehr sicher. Immer wieder kommt das Tragische herauf, unterströmen die Geschichten Melancholie und ein Gefühl der Verlorenheit, und einmal, in der Novelle „Im Schloß“, heißt es: „Liebe ist nichts als die Angst des sterblichen Menschen vor dem Alleinsein." Das aber sagt nun doch deutlich genug, daß es Storm in seiner Haut schon nicht mehr wohl war; daß er am Zustand der Welt zu leiden begann und daß es ihn traf, daß nichts von Dauer sein konnte, daß alles verging: Familie, Glück und Heimat, Liebe und Sommer; daß er den Untergang voraussah, daß er das Zittern und Beben spürte und daß es ihn beruhigt hat. Zwar versuchte er, zu halten, was ihm zu entgleiten drohte (genau wie Stifter), aber es gelang ihm nicht mehr, seinen Zweifel zu verbergen. und in seinen Geschichten liegt seine Welt im
Abendschein.
Das aber müßte man nun wieder hinzutun, um seinem Werk jene Tiefe zu geben, die sie für ihn hatte: diese Dimension des Leidens an Welt und Zeit. Franz Stuckert hat das getan und darum ist sein Buch über Storm so vorzüglich geworden. Er ließ das Getändel der üblichen Literatur über Storm hinter sich und fand den Zugang zu einer erschütterten Seele, die nach Beständigkeit und Unvergänglichkeit verlangte und die sich nicht damit abfinden konnte, daß es die Zeit gab, ein Vergehen des, Verwehendes. Er hatte den Blick für das Entscheidende. Sein Storm ist kein sentimentaler Nachbiedermeier, der wehleidige Geschichten machte, sondern ein aus den biedermeierlichen Träumen Aufgeschreckter, der eine Welt um sich zerfallen sah. Darum kann man Franz Stuckerts Buch nur rühmen, obwohl es, etwas konventionell disponiert, noch keine rechte Stoßkraft hat. Denn es geht in der Darstellung nicht vom Zentrum aus, sondern von der Peripherie, untersucht das Leben und die Persönlichkeit Storms, seine Erzählkunst und seine Lyrik, und ist mehr synoptisch als synthetisch. Aber wer es sorgsam liest, weiß darnach vieles anders. Dieses Ergebnis ist ermutigend, denn es durchbricht endlich den Bestand an überlieferten Phrasen und ist für die Deutung Storms vielleicht ein Neuanfang.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!