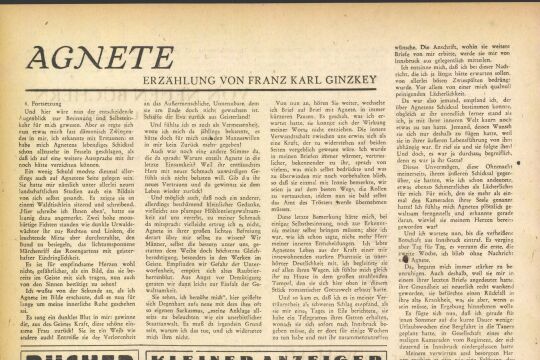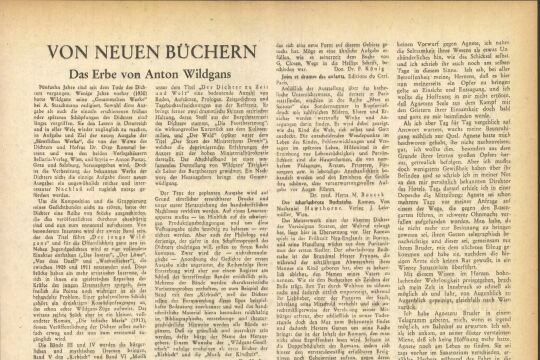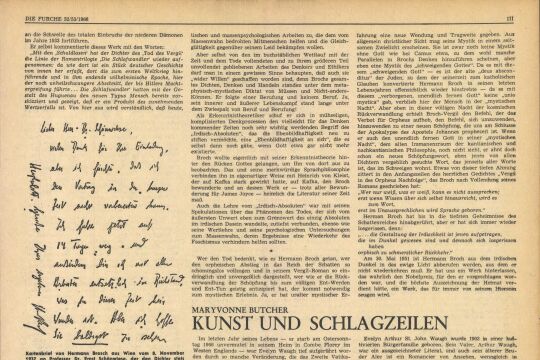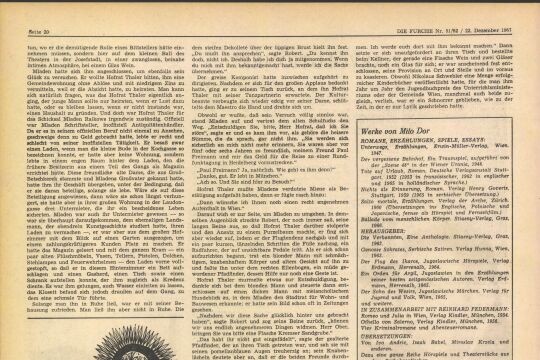John Bayley, der Mann von Iris Murdoch, ist ein bekennender Sonderling. Nach "Elegie auf Iris" nun "Das Haus des Witwers".
Kann man aus dem Dasein als Witwer einen Beruf machen? Es geht nicht, muss John Bayley, pensionierter Professor für englische Literatur in Oxford, nach dem Tod seiner berühmten Frau, der Schriftstellerin Iris Murdoch, erkennen. In seiner "Elegie für Iris" hatte er mit erschütternder Genauigkeit die letzten Ehejahre geschildert, in denen er seine an Alzheimer erkrankte Frau allein pflegte. Die Fortsetzung, "Das Haus des Witwers", handelt vom Versuch, mit dem neuen Leben, das ihm oft nicht mehr lebenswert scheint, zurechtzukommen.
"Wenn ich doch nur wirklich unabhängig wäre, frei von dieser Nervosität und den Ängsten und den Wutanfällen, die plötzlich so schlimm geworden waren ... Wieso hatte ich sie vorher nicht gehabt, als Iris krank war? Warum konnte ich nicht endlich auf schickliche Weise Witwer sein, ein Dasein führen, das doch bestimmt von Kargheit und würdevoller Leere geprägt war? Wie das Leben eines Mönchs, besonders eines Trappisten."
Es gelingt nicht, weil wohlmeinende Freundinnen ihm das Haus putzen und sein Bett wärmen wollen. Bayley, heute 77, ein exzellenter Kenner der englischen Literatur und ihres oft verqueren Humors, schildert mit eben diesem Sinn fürs Exzentrische seine Fluchtversuche vor wohl- und sonst noch wollenden Damen. Er sehnt sich nach Gesellschaft, aber einer, die so unaufdringlich ist wie jener Hund, von dem ein Hundehasser nach einem langen Abend sagte: "Ihr Hund, Madam, ist fast so gut wie überhaupt kein Hund." Bayley fühlt sich als Opfer ränkeschmiedender Frauen, die es auf sein ruhiges Haus abgesehen haben; doch als er sie in die Flucht geschlagen hat, überfällt ihn erst recht die Frage, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen soll. Und die Erinnerung an 45 Ehejahre, "obwohl doch die Ehe, wie wir beide wussten, die bestmögliche Art des Alleinseins war."
In seiner "Elegie für Iris" (derzeit in den Kinos: "Iris") hatte er sich zu den Schwierigkeiten bekannt, die das Zusammenleben mit einer Schriftstellerin mit sich bringt: Täglich viele Stunden Einsamkeit, und wenn Iris Murdoch nach dem Schreiben auftauchte, war sie oft noch in ihrer Phantasiewelt gefangen. Dennoch zog der Ehemann unmittelbar nach ihrem fünfjährigen Sterben ein positives Fazit: "Wir waren zusammen, weil uns die Einsamkeit, die jeder im anderen sah und erkannte, tröstete und beruhigte. Und so begann unsere Ehe. Und mit ihr begannen die Freuden der Einsamkeit. Darin lag kein Widerspruch - das eine vertrug sich vollkommen mit dem anderen. Zu fühlen, dass man gehalten und geliebt und begleitet wird, und doch alleine zu sein. Eng und physisch miteinander verflochten zu sein und doch die freundliche Gegenwart der Einsamkeit zu spüren, die so warm und tröstlich ist wie die Nähe selbst."
Im neuen Buch wartet er mit einem überraschenden Geständnis auf: "Ich hatte damals vor all den Jahren genau gewusst, dass es ein großer Fehler wäre, Iris zu heiraten. Eine ernstzunehmende instinktive Einsicht in meinem Wesen sprach dagegen." Er heiratete sie doch. Eine bekannte, banale Geschichte: Fast jeder hat das Gefühl, "geheiratet worden zu sein". Bayley erkennt: Auf das Ergebnis kommt es an, und das war in seinem Fall befriedigend. "Aber Witwer, so fand ich heraus, führen kein Leben. Sie warten darauf, dass etwas geschieht. Und wenn etwas geschieht, dann entsteht große Unordnung, der zu entkommen sie augenblicklich versuchen müssen."
Wenn nichts mehr da ist, das einen im Tageskorsett hält, fallen die Erinnerungen wie ungebetene Vogelschwärme ein. Zumal so viel von der Verstorbenen zurückgeblieben ist. Alle ihre Bücher liest der Witwer - unablässig. Und er beginnt, der Toten zu schreiben. Als Fachmann der englischen Literatur weiß er sich dabei in guter Gesellschaft: Schon der große Romancier Thomas Hardy sprach in vielen Gedichten mit seiner verstorbenen ersten Frau, während es bereits eine zweite gab, mit der er kaum redete.
Der Sinn für das Skurrile verlässt Bayley nicht, auch nicht in schwärzesten Stunden. Typisch englisch ist sein unbefangenes Bekenntnis, ein Sonderling zu sein. Er ist freilich ein Sonderling der Sonderklasse, kein selbstzufriedener, sondern ein selbstkritischer: "Im Lauf des letzten Jahres war ich, wie ich selber fand, unsympathischer geworden, und, was noch schlimmer war, langweiliger. Langweilig für mich selbst, unnett in meinem Inneren." Andererseits gibt er zu, wie sehr der gesellschaftliche Druck auf ihm lastet. Trauer wird vom Hinterbliebenen erwartet: "Und wirklich, manchmal ist es schwer gewesen zu unterscheiden, ob ich die Rolle eines trauernden Hinterbliebenen spielte oder ob ich diese tiefinnerliche Trauer tatsächlich empfand."
Die genaue Buchführung über den Weg aus der Verzweiflung scheut nicht vor erschreckenden Erkenntnissen zurück: "Ich erkannte mit einer gewissen Gleichgültigkeit, wie ungemein egozentrisch ich geworden war." Und noch etwas fällt dem Selbstbeobachter auf: "Jetzt kam ich vom Hundersten ins Tausendste und wusste nicht, ob es Erinnerung, Einbildung, etwas Altes oder etwas Neues war. Ein typisches Trauersyndrom?"
Man muss sich vor diesem Buch trotz seines bedrückenden Themas nicht fürchten. Es geht gut aus: Der Witwer verlässt schließlich das Haus der Erinnerungen mit allem darin aufgehäuften Plunder und findet bei einer Freundin seiner Frau auf der Kanareninsel Lanzarote ein neues Zuhause. Da wird der Ton leise und behutsam, fern ist aller Zynismus. Ein alter Mensch, der das Vergangene loslassen konnte, erlebt sich von allen Ängsten befreit.
Bayley hatte einen hervorragenden Ruf als Oxford-Professor. Seine Art, englische Literatur zu lehren, war undogmatisch, keiner Schule verpflichtet, er gehörte zu jenen akademischen Literaturvermittlern, denen es primär um die Anregung der Leselust ging und nicht um Überinterpretation oder Dekonstruktion von Texten. In seiner Generation wurde in Großbritannien die Theorie-Wut gegenüber der Literatur (vorherrschend in Frankreich) stets milde belächelt.
Das Kapitel, das er mit seinen jüngsten, überaus persönlichen Erinnerungsbüchern der englischen Literatur hinzufügt, weckt einen Verdacht: Stand er im Schatten einer Autorin von 27 Romanen, seiner Frau Iris Murdoch? Konnte, wollte er ihr auf dem Feld des Schöpferischen nicht Paroli bieten? Dass er packend und berührend erzählen kann, anders als seine Frau, aber ebenso gut, steht nun außer Zweifel.
Das Haus des Witwers
Von John Bayley. Übersetzung: Barbara Rojahn-Deyk. Verlag C. H. Beck, München 2002, 268 Seiten, geb., e 19,10
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!