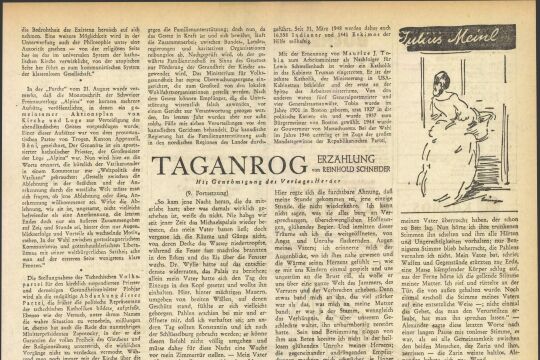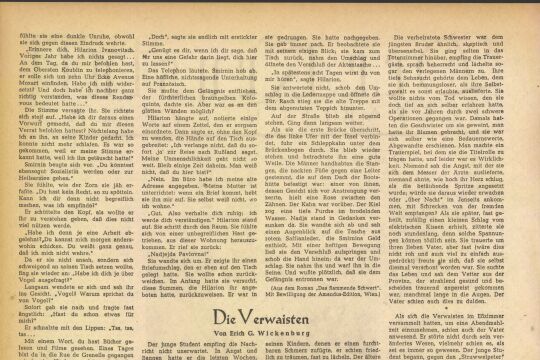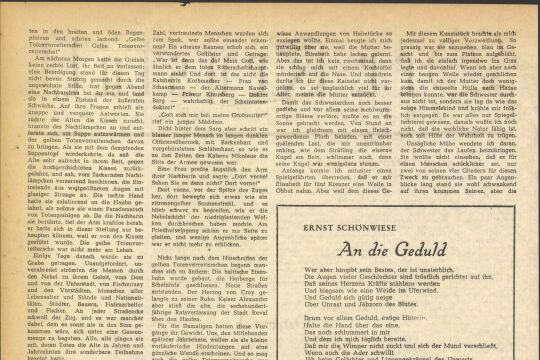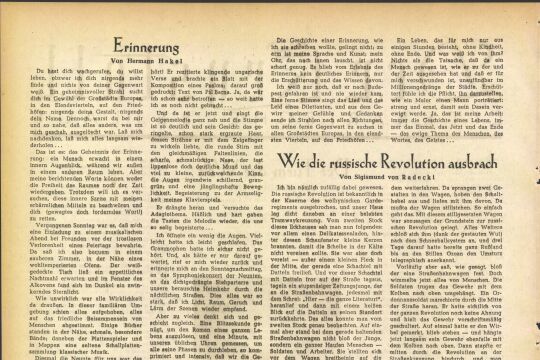Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die Blinde
Was heute wieder die Gemüter in vielen Ländern des Westens bewegt — das Schicksal der jüdischen Bevölkerung Rußlands — war in besonderem Maße zu Anfang dieses Jahrhunderts akut und wirkte noch auf spätere Generationen und weite Entfernungen nach. Der Zufall wollte es, daß die russisch — jüdische Tragödie mir gerade dort bewußt werden sollte, wo man auch heute wieder so sehr daran teilnimmt: im Heiligen Lande, das noch von England als Mandatsgebiet regiert wurde, also vor dem zweiten Weltkrieg.
Mein damals noch junges Leben durchlitt eine schwere und bitterte Krise, da ich — während der Frühling des Hohen Liedes über das blühende orangenduftende Land hinzog — in einem primitiven Spitalsbett nur wenig oberhalb der Meeresbucht von Haifa liegen mußte, die zu den schönsten des azurenen Mittelmeeres zählt. Ich aber war gefährlich verletzt und entstellt, sah nichts von der leuchtenden Pracht ringsum und was ich hörte, war nicht der Gesang der Vögel noch das Zirpen der unzähligen Zikaden — es war nur das leise Wimmern und Wehklagen meiner neuen Bettnachbarin, die ich noch gar nicht zu Gesicht bekommen hatte. Tags vorher war eine andere Bettinsassin aus der chirurgischen Abteilung des zu jener Zeit noch gar nicht großen, noch gar nicht straff organisierten Hadassah-Spitales entlassen worden — nur Gott weiß, ob geheilt oder aufgegeben.
Ich selbst konnte noch nicht an dem, was in meiner Umgebung vorging, wirklich Anteil nehmen. Denn all meine Sinne waren von dem erlittenen Schock und brennenden Schmerz eines bösen Verkehrsunfalles noch wie betäubt und gelähmt. (Und das war vielleicht gut so! Wohltäterin Natur hatte bewirkt, daß ich nur wie im Halbschlaf, ja wie im Trugtraum der Nacht — obwohl es doch am hellichten Tag geschehen war, wie ich später erfuhr — nur wie hinter Schleiern, undeutlich mitansah, wie ein mir treuer Freund aufschluchzend an meinem Lager zusammenbrach — wohl in der i Annahme ich sei eingeschlafen — vielleicht für die Ewigkeit.)
Doch ich erwachte aus der Betäubung und blickte um mich und über mich hinaus. Vielleicht war dies letztere meine Rettung? Wie hätte ich sonst dasjenige, was den Frohsinn meiner Jugend jählings durchbrach, ertragen und überwinden sollen?
„Sie wissen jetzt, mein liebes Kind, wieviel der Mensch ertragen kann, wenn er den Glauben an das Leben bewahrt!” Das hatte mein Arzt und
Lebensretter zu mir gesagt, der von der Hebräischen Universität Jerusalem hierher geeilt war, um die schon Aufgegebene doch noch zu operieren — und mit Erfolg. Ja, ich bewahrte den Glauben — „trotz alledem” — (hebräisch: bekol soth) — ein Wort, das man im Land Israel damals wie auch heute oft hört, an dem man sich aufrichtet.
So dauerte es nicht lange, bis ich auch die neue Patientin entdeckt hatte, die nun in meinem Nachbarbett lag. Warum man sie gerade in die chirurgische Abteilung gelegt hatte, ist mir unerfindlich geblieben, aber vielleicht gab es damals in dem noch kleinen Spital keine zuständige Klinik.
Zunächst sah ich nur den der Wand zugekehrten, mit Decken verhüllten Rücken eines anscheinend sehr schmalen Bündels. Doch bald erkannte ich, daß sich aus der bündelartigen Gestalt zwei schmächtige Ärmchen mit alten, runzeligen Händen vorstreckten, deren Finger wie suchend und tastend über die Bettdecke hin und her fuhren. Dann erst wurde ich auch des pergament- artig zerknitterten kleinen Gesichtes der Greisin gewahr, das gelblich und trocken aussah, eben wie jene Codices, mit denen ich zur Zeit meines damals erst jüngst abgeschlossenen Studiums oft in Berührung gekommen war. Die Augen der alten Frau waren starr, sie waren weit geöffnet, aber umflort und verwittert, sie schienen in die Weite zu blicken, der Nähe nicht gewahr.
Das Ferne aber, das längst Vergangene, Unsichtbare mochten sie so deutlich erblicken, als ob es jetzt und hier gegenwärtig, greifbar vorhanden wäre. Plötzlich öffneten sich die mumienhaft welken Lippen der Greisin und riefen zärtlich liebkosende Namen, als ob sie einem ganz kleinen Kinde galten. Es waren Laute und Silben in einer fremden Sprache, die ich zwar nicht kannte, aber erriet, da sie Anklänge ans Deutsche erkennen ließen, aber auch guttural Slavisches und Hebräisches enthielt dieser mütterlich-liebkosende jiddische Singsang, mit dem die Blinde unverkennbar ein nur für sie sichtbares Kindchen in den Schlaf zu singen bemüht war, wie ihre wiegenden, schaukelnden Armbewegungen erwiesen.
Ich erschrak zutiefst, da ich zu begreifen begann, diese blinde Mutter müsse geisteskrank sein; doch war kein Abscheu in dieser Ahnung enthalten, nur tiefes Mitleid. Nie zuvor hatte ich etwas ähnlich Erbarmenswürdiges gesehen, ja nicht geahnt, daß derlei menschenmöglich sei. Erst als die alte Frau laut stöhnte und Schreie ausstieß, ohne daß ich —
selbst wehrlos ans Bett gefesselt
— aufspringen und ihr helfen konnte, begann ich laut nach der Schwester zu rufen.
Da hörte man eine rauhe Männerstimme. Mit energisch festem Schritt
— von der fast unhörbar leisen Schwester gefolgt — näherte sich der Primarius unserem Krankenabteil. Doch noch ehe er es betreten konnte, schnellte — zu meinem verblüfften Entsetzen — die alte Frau auf ihrem Lager hoch, als ob sie sich jemandem entgegenwerfen wollte. Gleich beugte sie sich tief vornüber auf die Decke, sie streichelte und hüllte ein nur ihr sichtbares kleines Wesen angstvoll beschützend fest ein, zärtlich tröstende Laute murmelnd. Erst als der Männerschritt ganz dicht bei ihrem Lager einhielt, schrie sie mit dem schrillen Diskant letzter Verzweiflung auf: „Nit mein Bübele, meinen Rubentschik derft ihr hargėnen (das heißt töten), Panje Kosaken, da — nehmt mich — stoßt zu — aber nit mein Kindele — harget mich!” Dabei berührte sie wie in demütigem Flehen das Fußende des Bettes mit ihrem winzigen Kopf, zugleich das unter ihr vermeinte Wesen verdeckend.
Auf einen Wink des Arztes hin gab die Schwester der sich leidenschaftlich aufbäumenden alten Frau eine Spritze, die diese sofort beruhigte und in einen leichten Schlaf sinken ließ. Doch selbst noch im Schlummer müssen am inneren Auge derblinden Mutter die Schreckensbilder der Vergangenheit — wenngleich durch die Droge gemildet und der furchtbaren Pogromgreuel entkleidet — vielleicht sogar friedlich verklärt — vorübergezogen sein. Denn immer wieder drückte sie das unsichtbare, das (wie die alte Oberschwester mir später erklärte) vor nicht weniger als vierzig Jahren tatsächlich bei einer Judenverfolgung in Rußland ums Leben gekommene Kind, ihren lebend gewähnten kleinen „Rüben”, an ihr Herz, schaukelte das erträumte Kind, ihr Kleinod, in beiden Armen, und summte dazu mit kindisch trällernder Stimme, wie sie sie in ihrer Jugend gehabt haben mochte, jene alten, wunderlich liebevollen Wiegelieder, wie sie die jüdische Gefühlswelt in der stets von tausend Gefahren bedrohten und dennoch eigenartig traulichen Enge des polnischen und russischen, des jiddischen „Städtels” und Gettos einst in so unerschöpflichem Maße hervorgebracht hat.
Noch am gleichen Tage wurde die arme, blinde Mutter, der in dem mörderischen Pogrom neben und mit dem Kind auch der Verstand verloren gegangen war, in ein anderes Abteil des Spital es gelegt; ich habe sie nie wiedergesehen — aber auch niemals vergessen.
Mich hatte diese Konfrontation mit dem tragischen Schicksal einer Mutter, die mir als Sinnbild des jü- diechsn Schicksals in Osteuropa erschien, so sehr bewegt, daß ich ein wenig über mein eigenes Schicksal hinausgehoben wurde und meiner brennenden Schmerzen zumindest zeitweise vergessen konnte. Beinahe vergessen. Weiter leben, an das Leben, an Gott glauben! An den Menschen glauben Und helfen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!