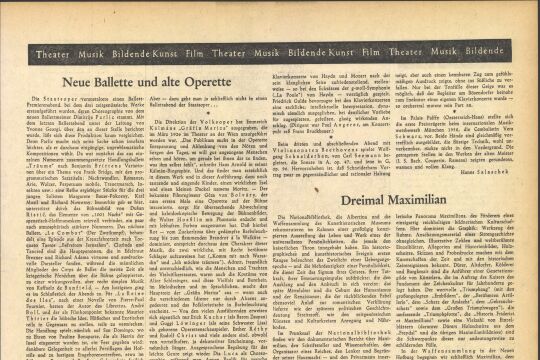Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ballett und surreale Kurzopern
Das Landestheater Salzburg brachte drei neue Ballette und als österreichische Erstaufführung die Kurzoper „Les Mamelles de Tir&ias“ von Francis Poulenc heraus. —Zunächst zu den Balletten:
Während der „Rienzi-Ouvertüre“ von Richard Wagner projizieren die Tänzer ihr Zittern ins Publikum, das dann innerlich zu zittern begann. Es war fast peinlich mitanzusehen: Kaum eine Figur ist gestanden, oft konnte man fast nicht unterscheiden, was schon Schritt, was noch Nachsetzen war.
Ein wenig besser klappten die Solopartien in Wagners „Siegfriedidyll“. Sogar gut ist Ursula Stein, die gegen das Ensemble durch schwingende Leichtigkeit absticht. Sie beherrscht die Figuren, ihre Bewegungen sind in sich rhythmisch. In Evzen Soucek hat sie einen Partner, auf den sie sich verlassen kann. Auch das Kollektiv ist besser als in der „Rienzi-Ouvertüre“. Gerhard Platiil hat hier in die Choreographie moderne Figuren eingearbeitet. Wenn auch manches an Bodenturnen erinnert, so unterstreichen doch die revue-ent-lehnten Figuren effektvoll das Puppenhafte der Szene und geben Spannung zwischen Bewegung und Statik.
In der Ballettpantomime „El amor brujo“ von Manuel de Falla kommt dann sogar Temperament auf, wenn spanische Motive musikalisch und tänzerisch aufgegriffen werden. Auch der Einschlag der Populärmusik wirkt im ganzen nicht heterogen. Die Zigeunerweisen, die Ingrid Mayr singt, könnten etwas feuriger kommen, auch von Paul Angerer, der das Mozarteum-Orchester wie gewohnt sicher leitet. Doch trösten sie trotzdem zum Teil über die hier recht dürftige Choreographie hinweg. Das Hauptstück des Abends bildet die österreichische Erstaufführung der Kurzoper „Les Mamelles de Ti-risias“ von Francis Poulenc mit dem Text von Guillaume Apollinaire. — Das so einfache Stück ist dennoch recht problematisch „Les Mamelles de Tiresias“ trägt (bei Apollinaire) den Untertitel „drame surrtaliste“. Nach diesem Untertitel taufte Andre Breton 1917 einen ganzen Kunststil: den Surrealismus. „Les Mamelles de Tiresias“ ist, so gesehen, das erste surrealistische Drama. Was vor fünfzig Jahren neu war, ist — immer noch zu neu für das heutige Theaterpublikum. Die Zuschauer fragen sich (teilweise ihre Nachbarn): Warum hat Therese plötzlich einen Bart? Warum erscheint der Ehemann der Therese plötzlich als Frau? Warum produziert er täglich 900.909 Kinder? Warum produziert er täglich genau 900.909 Kinder? Man versucht immer noch, die Logik einer anderen Dimension, die der „Wirklichkeit“, in das Stück zu projizieren — und versteht es deshalb nicht. Allenfalls lacht man darüber, daß Therese Luftballons als Brüste unter dem Hemd trägt, und darüber, daß zwei Herren auf Rollschuhen auf die Bühne fahren. Man versteht nicht, daß das dort oben wahrlich (um nicht zu sagen müssen: wirklich) ganz einfach so ist. Das Publikum hat, so scheint es, gar nicht erst gelernt, surrealistisches Theater zu sehen. Paraphrasen, Verfremdungen, expressionistische Bühnentricks gibt es zwar auch in der Wirchlichkeit nicht; aber sie haben etwas zu bedeuten; sie sind wenigstens wirklichkeitsbezogen. Un-deut-barer Manierismus des Surrealismus aber bleibt für ein Publikum, das im Grunde nur gewohnt ist, die Geschehnisse von der Straße in ihrer zweiten Wirklichkeit auf der Bühne zu sehen, unverständlicher Un-Sinn.
Daher kommt das Stück nicht an, wie es ihm gebührt. Schuld der Inszenierung von Gerhard Platiel ist es nicht. Trotzdem bekommen Boris Rubasch-kin (als Theaterdirektor und Polizist), Robert Granzer (als der Ehemann), Kurt Kessler und Kurt Strauß (als die beiden Herren) viel Beifall für ihren possenhaften Gesang. Maria Antonia Harvey bringt die Therese musikalisch und spielerisch so „na-türlich“-surrealistisch dar, daß das Publikum ab und zu zu verstehen beginnt, daß nichts zu verstehen ist, außer dem, was und wie es dort oben zu sehen und zu hören ist: nichts weiter oder „dahinter“. Und auf der musikalischen Ebene korrespondiert wohl das Publikum mit dem Bühnengeschehen. Die Musik von Francis Poulenc ist, da sie dem Text und der Darstellung adäquat konzipiert wurde, nicht von dem Stück zu „sublimieren“; Musik ist von vornherein „sublim“; sie läßt keine Möglichkeit für Fragen. — Paul Angerer scheint das Dirigieren hier Spaß zu machen und Spaß zu sein. Richard Helliger hat diesmal den Chor wirklich einstudiert, und das „Juckt es euch, kratzt euch mit Vergnügen!“ das als Motto für diese surrealistische Posse (wenn es so etwas gibt) gelten kann, ist wirklich vergnüglich anzuhören — erfreulich weit entfernt von jedem Tiefsinn, diesem schlimmsten Verstoß des manifesti-ven späteren Surrealismus gegen diesen. (Warum bringt man nicht eine zweite Kurzoper, statt das Ballett mit etwas zu quälen, das es nicht bewältigt?)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!