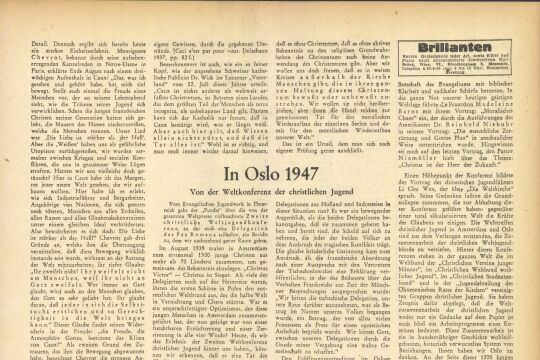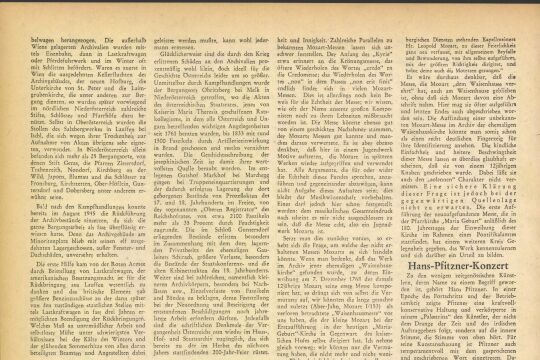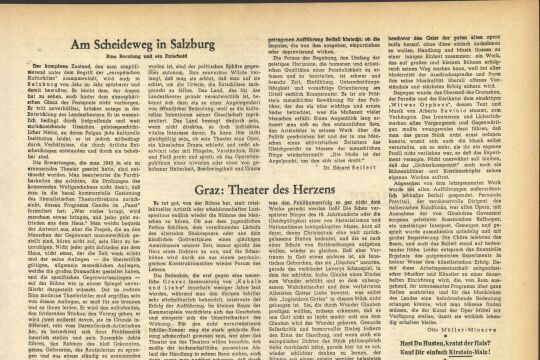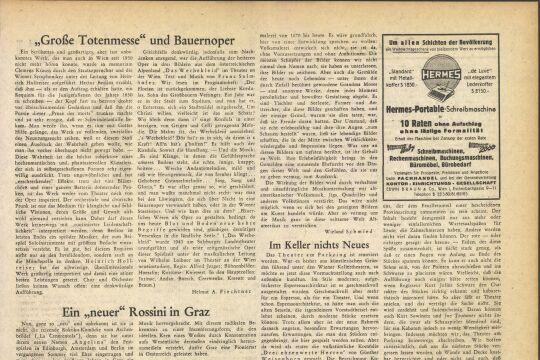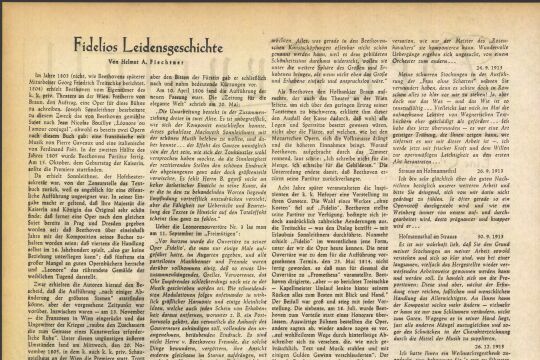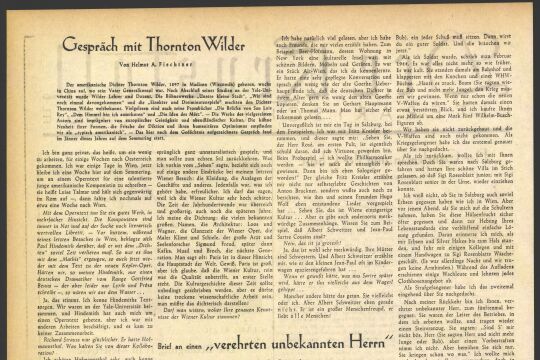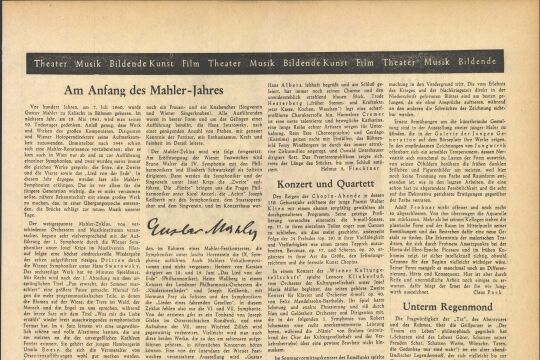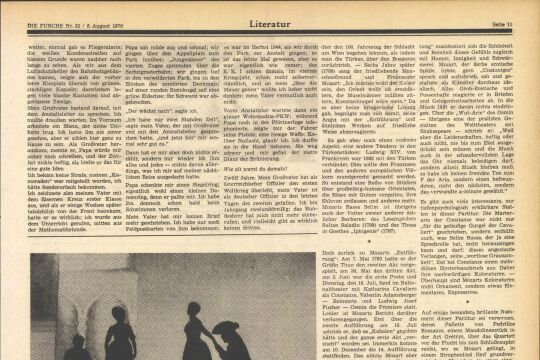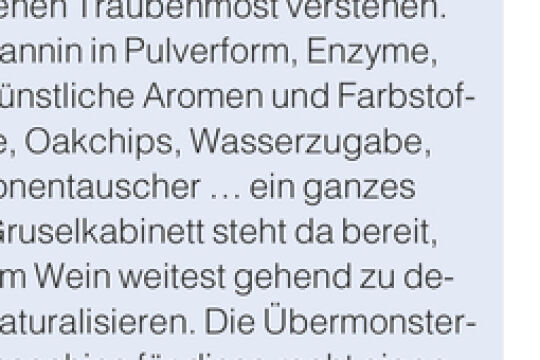Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Unzulänglicher Rettungsversuch
Zum Unterschied von einem gelehrten Werk macht ein wissenschaftlicher Apparat bei einer Oper niemandem Freude. Das sogenannte einfache Publikum wird verwirrt und überflüssigerweise darauf hingewiesen, daß es ein Stückwerk gesehen hat, was es ohne Kommentar vielleicht gär nicht bemerkt hätte; der Fachmann aber, der sich für einen Kenner hält, beginnt sogleich zu nörgeln und will wissen, warum gerade dieses und nicht jenes Stück, das doch viel besser gepaßt hätte, zur Ergänzung herangezogen wurde. Keinem wird es zu Dank gemacht, und der Restaurator darf noch froh sein, wenn die Zunft ihn nicht beschimpft.
Diesem schnöden Undank hat sich der musikalische Bearbeiter der „Zaide“ in der Salzburger Fassung wohlweislich dadurch entzogen, daß er seinen Namen weder im Programm noch im Almanach nennen ließ. In den Besprechungen kommt er daher ungeschoren davon, wogegen nun jedermann mit doppelter Lust an dem armen Gandolf Buschbeck, dem Regisseur und Text- bearbeiter der Aufführung, sein kritisches Mütchen kühlt.
Mozarts Singspiel „Zaide (KV 344, ursprünglich, „Das Serail“ genannt), dieser noch etwas linkischen Vorstudie zur „Entführung“, fehlen die Ouvertüre und das Finale, und manche behaupten, es fehle der ganze dritte Akt, obwohl man sich beim besten Willen nicht vorstellen kann, was nach der allgemeinen Versöhnung am Ende des zweiten Aktes, in diesem noch hätte passieren können. Als Ouvertüre werden in Salzburg zwei Sätze aus der Jugend- Symphonie KV 74 gespielt, das Finale stammt aus der Musik zu „König Tbamos“ (KV 345), die Mozart unmittelbar nach der „Zaide“ komponiert hat. Buschbeck führte zur Belebung ein Wiener Wäschermädel ein, das — mit musikalischer Begleitung — selbst wiederum der gleichfalls fragmentarischen Opera buffia „L’Oca del Cairo“ (KV 422) entlehnt wurde. Die Salzburger Fassung wurde also aus recht weit aus- einamderliegenden Werknummern ergänzt, doch ist das gewiß nicht der größte Fehler der Aufführung.
Der besteht vielmehr — da gibt es kein Pardon — in der angesichts des Festspielrahmens geradezu sträflich dilettantischen Wiedergabe, für die man die Wiener Kammeroper kritisch in Kleinholz zerlegt haben würde, hätte sie mit einer solchen Aufführung ihren Beitrag etwa zu den Wiener Festwochen ableisten wollen. Die alljährlichen Aufführungen unbekannter Mozart-Opern im Hof der Salzburger Residenz strapazieren zwar stets das Wohlwollen der eingeladenen Kritik über Ge bühr (was drückt man nicht alles zu als Dank dafür, einen dieser rührenr den frühen dramatischen Versuche Mozarts aufgeführt zu sehen!), aber so wie man in diesem Jahr die „Zaide“ singt und spielt, geht es wirklich nicht.
Es hat keinen Sinn, ein an sich schon nicht lebenskräftiges Werk durch ¡die Mitwirkung von schlecht geführten oder unbegabten Darstellern noch um den letzten Rest seiner möglichen Wirkung zu bringen. Der Name Ingeborg Hallstein (Zaide) mag auf manche attraktiv wirken, doch was nützt das, wenn diese Sängerin in der Partie ¡der Zaide dann immer wieder durch ihren stimmlich unausgeglichenen, teils hölzernen, teils forcierten Vortrag enttäuscht? Mit dem Tenor Horst Laubenthal als Gomatz ist noch weniger Staat zu machen, obwohl die Stimme gar nicht so schlecht ist. Seine mit einem Melodram statt des üblichen Rezitativs eingeleitete Arie zu Beginn ist sogar recht interessant, aber wenn man ihm ¡dabei zusielht, ¡glaubt man immer nur das rührende Volkslied „Verlassen, verlassen bin i“ zu hören, von so suggestiver Kraft ist seine darstellerische Ohnmacht. Bleiben Barry McDaniel als Allazim, von dem gelernte Salzburger behaupten, er habe eine prächtige Stimme, und James Harper als zorniger Sultan Soliman, der davon gelegentlich sogar auch etwas zeigt. Seine hoch- dramatische „Wut“-Arie, in der Mozart den Auftritt Pizarros im „Fidelio“ vorweggenommen hat, gehörte zum Besten der ganzen Aufführung, die durch Robert Granzer als Osmin Mikrospuren von Humor und durch Monique Lobasa als versklavtes Wäschermädel einen etwas derben und deplacierten Stich ins Wienerische erhielt.
Bernhard Conz leitete als Dirigent die Aufführung. Mehr ist darüber nicht zu sagen. Immerhin hielt er das Mozarteumorchester über zwei Stunden lang im Takt, und das schien manchmal gar keine so geringe Leistung zu sein. Emie Kniepert hatte Bühnenbilder und Kostüme beigesteuert, die einer besseren Aufführung würdig gewesen wären. Stolz wiehernd und mit zurückgeworfenem Kopf verließ das Pferd, das den Sultan bereingetragen hatte, den Schauplatz. Das war ¡gekonnt!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!