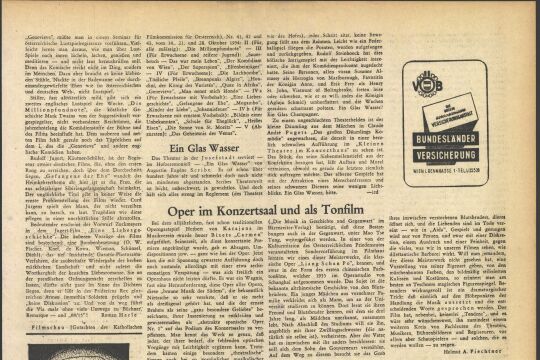Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ausklang in Graz
Langweilig an Giacomo Meyerbeers kaum noch gespielter Oper „Die Afrikanerin“ ist eigentlich nur die Musik. Sie schleppt sich reizlos von einem Rezitativ zum anderen, ohne daß jemals so etwas wie ein zündender Funke auftauchte. Die Handlung indes ist zwar langwierig und kompliziert, ermüdet aber in ihrer naivkrausen Exotik weit weniger als die dünnblütige und schlaffe Musik. Der Gastregisseur Hans Hartleb, als Entdecker verschollener Werke kein Neuling, wählte Meyerbeers „Afrikanerin“ für die letzte Premiere der Grazer Saison, weil er „dem Opem- museum entfliehen“ möchte. Die Öffnung des Repertoires nicht nur in die Gegenwart, sondern auch in die Vergangenheit, scheint ihm dazu ein Weg zu sein. Wenn diese „Afrikane- rin“ (die eigentlich eine Inderin ist) irgendwelche Uberlebenschancen auf unseren Bühnen hat, so günstigstenfalls mit einer Wiedergabe, die nicht unter dem beachtlich hohen Niveau der Grazer Aufführung liegt. Hans Hartleb gelang es im Verein mit dem Bühnenbildner Wolfram Skalicki, das Werk in der Tradition der großen französischen Oper zu belassen und den extravertierten Stil dieses Genres hervorzukehren, ohne ihn zu ironisieren. In den Dekorationen, die für sich allein schon den Besuch der Vorstellung rechtfertigten, schwingt ein Hauch der „Salle Garnier“, Place de l’Opėra, mit. Pomp, aber auch Staub der ganzen Gattung sind sozusagen als Orientierungssignal miteingebaut. Das hat, zusammen mit dem — nicht persiflierten, aber doch sehr deutlich „gezeigten“ — Darstellungsstil, einen eigenartig intellektuellen Charme. Der bewährte Gustav Czerny hatte die musikalische Leitung, auf der Bühne standen die besten Sänger des Hauses, allen voran Roberta Knie in der Titelrolle mit hinreißender Brillanz, dann Margarita Kyriaki als Ines und Jose Perez als Vasco da Gama: ein doch recht schöner Abschluß einer nicht immer ganz schönen Saison.
Jose Perez, beliebter und gefeierter Primo uomo der Grazer Oper, hatte vor kurzem viel Erfolg gehabt in einer Neuinszenierung von Verdis „Othello“ durch Reinhold Schubert: ein junger „Mohr“ mit schlanker, metallischer Stimme und einer köstlichen Desdemona (Roberta Knie) als Partnerin. Berislav Klobučar zeigte sich als Dirigent von seiner temperamentvollsten Seite. Nur der Jago Dusan Popovics konnte encht recht befriedigen: ein grausiger Bösewicht aus der Mottenkiste, dort, wo sie am tiefsten ist.
Fritz Zecha inszenierte im Schauspielhaus „Die schöne Helena“, eine Operette für Schauspieler von Peter Hacks (nach Meilhac und Halėvy) — als österreichische Erstaufführung. Es war ein großer Publikumserfolg, beinahe ein Kassenschlager. In der Tat ein recht angenehmer Abend, an dem die Offenbachsche Parodie zum zrweitenmal parodiert wurde: mit antiker Bläue und Makart-Plüsch, mit Kinderchor und Horizontleuchten, mit Hammondorgel und halbhoher Brecht-Kurtine, mit Gags, Gags und nochmals Gags. Und doch konnte man der Sache nicht ganz froh werden. Eine blendende Inszenierung von Zechascher Perfektion, aber doch viel mehr Vorführung einer gutgeölten Theatermaschinerie als Spürbarmachen einer kritischen Gesinnung. Der großartige Rudolf Buzcolich, für kurze Zeit wieder nach Graz heimgekehrt, und die prächtige Marianne Kopa.tz als infantil-erotische Helena sorgten allerdings für die graziöse Atmosphäre einer „Antike der Poesie“, die der Autor Peter Hades verlangt.
Ein bürgerliches „Heldenleben“ stellt Sternheim in seiner Komödie vom „Bürger Schippel“ auf die Bühne, eine kleine, runde Welt, die mit einem Schleier aus klischierten Metaphern sich vom Draußen abgrenzt, sich in ihren „abgezirkten Gebieten“ selbst genug ist und in den tradierten Schablonen der Opernromantik mit dem .Freischütz’, dem .Tannhäuser’, mit Schiller und Shakespeare, aber auch mit Uhland ihren spießerischen Neigungen frönt. Ein boshaftes Stück, das so manchen Anachronismus demaskiert, und dem Stem- heims preziös-expressionistische fSpraęhę literarischę Quglitatsmprke ist. Rudolf Buczoličh, der meisterhafte Charakterdarsteller, war der Prolet Schippel, der sich mit Hilfe musischer Qualitäten bis zum sath- faktionsfähigen Bürger emporhantelt. Reinhold Schubert, der Intendant, hatte recht geschieht inszeniert Christian Schieckel eine feinsäuber- lich ironisierte Idylle auf die Bühne, gestellt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!