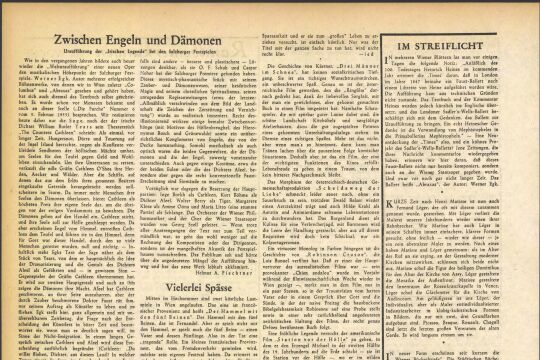Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das Abgründige in den Mahons
„Der Freunde, der daher kam und große Reden führte, war mir wie ein Wunder, aber dann habe ich die Schlägerei vor dem Hause gesehen und den Hieb mit der Hacke, und jetzt erkenne ich den Abgrund zwischen einer Heldensage und der schmutzigen Wirklichkeit.”
So bekennt die Schankwirtstochter Pegeen am Schluß der Oper, als ihr eine Welt zusammengebrochen ist. Eine Welt, deren Mittelpunkt der „Held” Christy bildete, ein frustrierter, verängstigter Bursche, der meint, in einem Anfall von Auflehnung seinen herrischen Vater mit der Hacke erschlagen zu haben. Darauf flüchtet er in die elende Kneipe eines abgelegenen irischen Dorfes und somit geradewegs in die Arme einer jungen Wirtin. Für die Dorfmädchen, allen voran Witwe Quinn, die ihren Mann tatsächlich umge- brachit hat, wird er zum interessanten Fall. Sie hofieren und beschenken ihn und lauschen begierig seinem phantastischen Mordbericht. Verschlagen und eitel, verliebt in sein Spiegelbild, wird er zum Sieger bei dörflichen Preisspielen und wirft sich in Pose. Als sein vermeintlich toter Vater leibhaftig erscheint, holt er noch einmal zum Schlag gegen ihn aus. Doch diesmal verzeihen die Dorfbewohner, Zeugen der gräßlichen Tat, nicht mehr. Entschlossen wollen sie ihren winselnden „Helden”, der sich verzweifelt an ein Tischbein klammert, dem Gericht überliefern. Da wankt abermals sein Vater als Deus ex machine herein, blutend, aber glücklich über seinen Jungen, der ja doch ein ganzer Kerl ist. Irische Familienbande über alles — und so torkeln die beiden Mahons einträchtig durch die gaffende Menge in die rauhe Seeluft.
Gieselher Klebe, geboren 1925, ein Freund der Literaturoper, wählte in seinem achten Bühnenwerk die Vorlage des irischen Dichters J. M. Synge „The Playboy of the Western World”. Nach der Übersetzung von Annemarie und Heinrich Böll schuf er sich sein eigenes deftiges, naturalistisches Libretto. „Mir geht es beim Komponieren um eine möglichst weitgehende Verständlichkeit des Ausdrucks ohne irgendwelche technisch-theoretischen Erläuterungen”, meint Klebe, der eine „Oper für Sänger” schrieb. Und für ein Publikum, das sich genügend Naivität für skurrilen Humor, Spinnerei und Hintergründigkeit einer uns befremdenden Mentalität bewahrt hat.
Der Musik gelingt es, die Atmosphäre einer Szene malerisch umzusetzen und stark zu suggerieren. Sie hält sich eng an den Text und übernimmt den Duktus der Sprache in klarer Plastizität. Hart rhythmisiert, mit sicherem Gefühl für dramatische Ausbrüche wird am Wort entlang musiziert Durch Chromatik und atypische Intervalle entstehen eigenwillige Klangverbindungen, die mehr illustrativ als dramaturgisch zu werten sind und oft von den bewußt synchron zur Musik geführten Gesten (ein origineller Einfall des Regisseurs Imo Moszkowicz) unterstützt werden. Die Instrumentation benutzt ihre ironischen und hintergründigen Aspekte zur Charakterisierung der Situation. Pauken, Marimbaphon, eine Jazzbatterie, Harfe, Saxophon, Klavier und elektronische Orgel heizen den großen Orchesterapparat auf, ohne jedoch die prachtvollen Stimmen der Interpreten zu verdecken.
Die Besetzung ist erstklassig: im malerisch-schmuddeligen Bühnenbild Max Röthlisbergers nutzt der Regisseur in originellen Gruppenkombinationen den Raum in Breite und Tiefe situationsgerecht aus. Zwischen fahrigen Gesten, hektischen Aktionen und plötzlich zurückgenommenen, dumpfen Monologen Siedelt er diese abgründige Welt des falschen Pathos und mißgedeu- teten Heldentums an. Pegeen (Gerlinde Lorenz) dominiert mit fanatischem Spiel und leuchtendem Sopran, der, selbst bis an die Grenzen geführt, makellos jubiliert. Ihr ebenbürtig: der metallische Tenor Sven Olof Eliassons (Christy) und der markige Bariton Ernst Gutsteins (Vater). Die beiden Mahons bieten eine fesselnde psychologische Studie. Ellen Kunz (Witwe Quinn) ist ein mannstolles Prachtweib — die übrigen Darsteller müssen sich leider mit einem Pauschallob begnügen.
Ferdinand Leitner sorgt für exakte Bewältigung schwieriger Orchesterpassagen mit auffallenden Taktwechseln, beherzigt die Partituranweisung: „Vorzutragen wie mit mindestens 1,5 Promille im Blut” und vermittelt souveräne Homogenität zwischen Bühne und Klagapparat, belebt selbst noch eine streckenweise Gleichförmigkeit 2u Beginn des dritten Aktes. — Sehr lebhafter Beifall für eine aparte Uraufführung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!