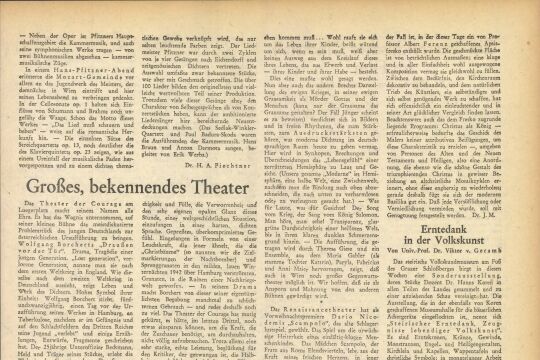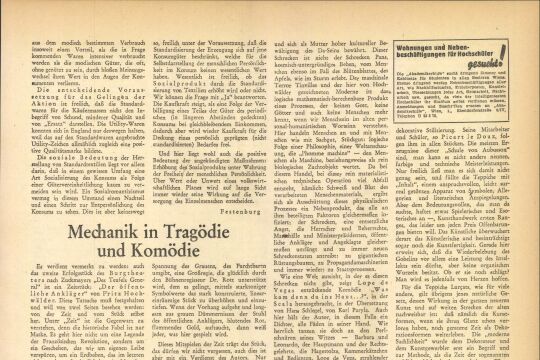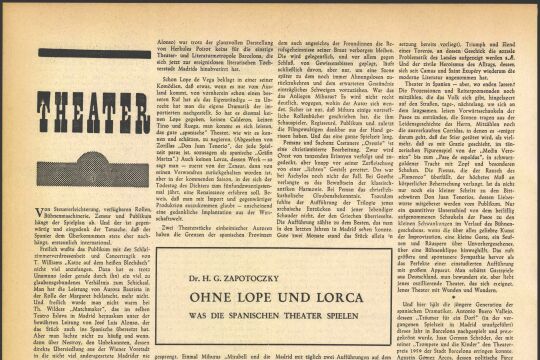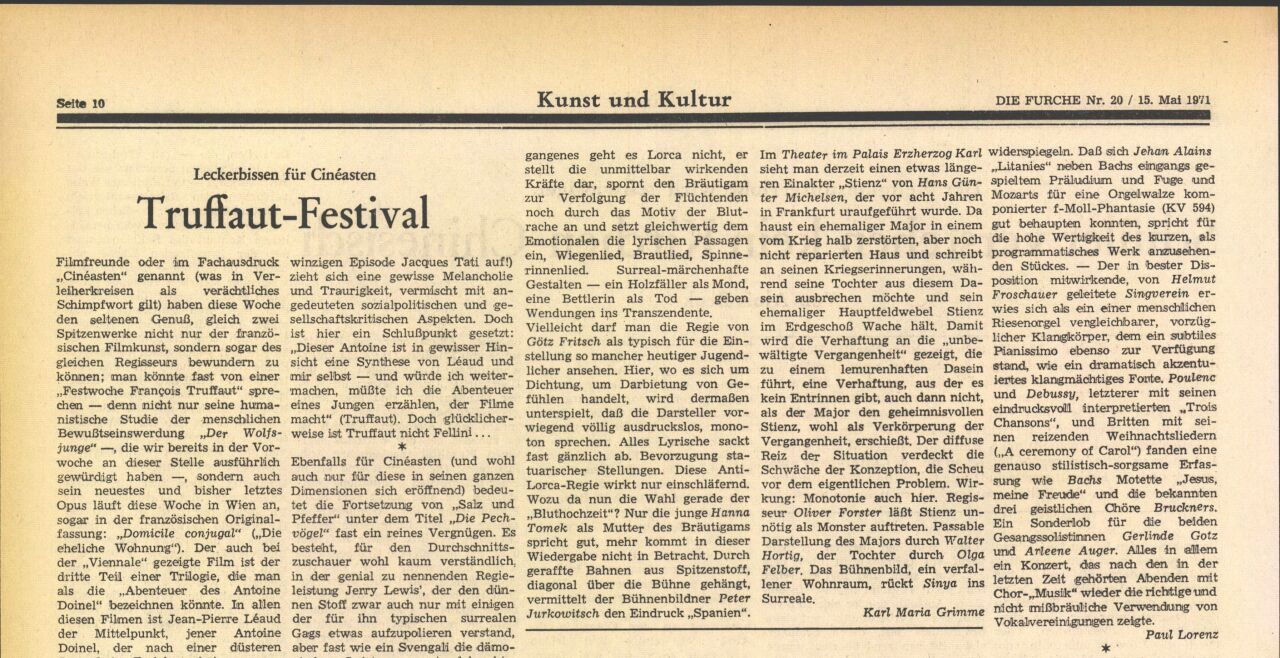
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Theater am Rand
Schon Aristophanes hat sich über das Streben nach völliger Gleichheit, nach einer Staatsordnung bei der „alles Eigentum aller” ist, lustig gemacht. In seiner Komödie „Frauenvolksversammlung” treibt er dies soweit, daß unter der Regentschaft emanzipierter Frauen auch die Weiber Gemeingut sind. Aber dieser materielle und sexuelle Kommunismus scheitert am Egoismus der einzelnen, im besonderen an der Gier der alten Weiber, bei denen die Jünglinge zuerst ihrer volksverord- neten Pflicht zu genügen haben. Diese 2363 Jahre alte Komödie wirkt auch heute erstaunlich aktuell. Nun führte das Frankfurter Kellertheater „Die Katakombe” laut Programmzettel das von Claus Bremer übersetzte und von Rudolf Wolfgang Schnell bearbeitete Stück als Gastspiel im Kleinen Theater der Josefstadt vor. Die Truppe nennt sich „feminine Schauspielerkommune”, worüber man nachdenken mag, denn sie besteht aus drei jungen Mädchen und einem jungen Mann. Aber von Aristophanes bleiben lediglich Ansätze der Handlung, mit dem herausgezupften Verbalen wird etwa in Handkescher Manier jongliert, wobei der Regisseur Marcel de Schilb die Darsteller auf giftgrünem Rasen murmeln, dumchein- anderreden, schreien und alle möglichen Bewegungskünste vorführen läßt. Es herrscht fröhliche Unbekümmertheit, bei Conny Hannes Meyer wäre solch eine Darbietung präziser und Aristophanes ungleich näher.
*
Dramatik, durchflochten von Lyrischem, bieten die Stücke von Federico Garcia Lorca. Stärkste Leidenschaft, die zu blutiger Aktion führt, wird feierlicher Gesang. Die lyrische Tragödie „Bluthochzeit”, die derzeit von „La Mama Wien” im Vortragssaal des Museums des 20. Jahrhunderts zur Aufführung gelangt, hat eine Braut zur Hauptgestalt, die ihren Bräutigam, einen reichen jungen Bauern, lieben will, aber Leidenschaft, stärker als der Vorsatz, bricht durch, sie flieht von der Trauung weg mit dem verheirateten Jugendfreund. Zwei Tote gibt es, ihn und den Bräutigam.
Die Ursache dieses Unheils wird gerade nur angedeutet: Sie heiratet den Jugendfreund nicht, weil sein Besitz zu gering war. Materielle Beweggründe hatten Vorrang. Doch um diese Kausalverknüpfung, um Ver gangenes geht es Lorca nicht, er stellt die unmittelbar wirkenden Kräfte dar, spornt den Bräutigam zur Verfolgung der Flüchtenden noch durch das Motiv der Blutrache an und setzt gleichwertig dem Emotionalen die lyrischen Passagen ein, Wiegenlied, Brautlied, Spinnerinnenlied. Surreal-märchenhafte Gestalten — ein Holzfäller als Mond, eine Bettlerin als Tod — geben Wendungen ins Transzendente. Vielleicht darf man die Regie von Götz Fritsch als typisch für die Einstellung so mancher heutiger Jugendlicher ansehen. Hier, wo es sich um Dichtung, um Darbietung von Gefühlen handelt, wird dermaßen unterspielt, daß die Darsteller vorwiegend völlig ausdruckslos, monoton sprechen. Alles Lyrische sackt fast gänzlich ab. Bevorzugung statuarischer Stellungen. Diese Anti- Lorca-Regie wirkt nur einschläfernd. Wozu da nun die Wahl gerade der „Bluthochzeit”? Nur die junge Hanna Tomek als Mutter des Bräutigams spricht gut, mehr kommt in dieser Wiedergabe nicht in Betracht. Durch geraffte Bahnen aus Spitzenstoff, diagonal über die Bühne gehängt, vermittelt der Bühnenbildner Peter Jurkowitsch den Eindruck „Spanien”.
Im Theater im Palais Erzherzog Karl sieht man derzeit einen etwas längeren Einakter „Stienz” von Hans Günter Michelsen, der vor acht Jahren in Frankfurt uraufgeführt wurde. Da haust ein ehemaliger Major in einem vom Krieg halb zerstörten, aber noch nicht reparierten Haus und schreibt an seinen Kriegserinnerungen, während seine Tochter aus diesem Dasein ausbrechen möchte und sein ehemaliger Hauptfeldwebel Stienz im Erdgeschoß Wache hält. Damit wird die Verhaftung an die „unbe- wältigte Vergangenheit” gezeigt, die zu einem lemurenhaften Dasein führt, eine Verhaftung, aus der es kein Entrinnen gibt, auch dann nicht, als der Major den geheimnisvollen Stienz, wohl als Verkörperung der Vergangenheit, erschießt. Der diffuse Reiz der Situation verdeckt die Schwäche der Konzeption, die Scheu vor dem eigentlichen Problem. Wirkung: Monotonie auch hier. Regisseur Oliver Förster läßt Stienz unnötig als Monster auftreten. Passable Darstellung des Majors durch Walter Hortig, der Tochter durch Olga Felber. Das Bühnenbild, ein verfallener Wohnraum, rückt Sinya ins Surreale.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!