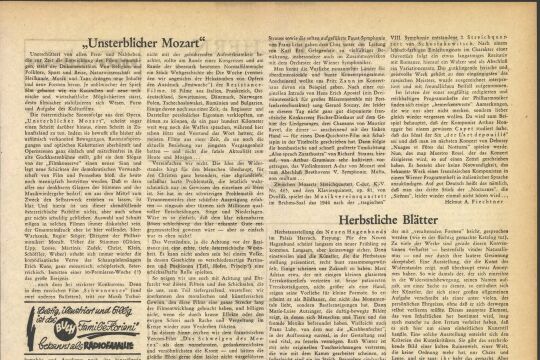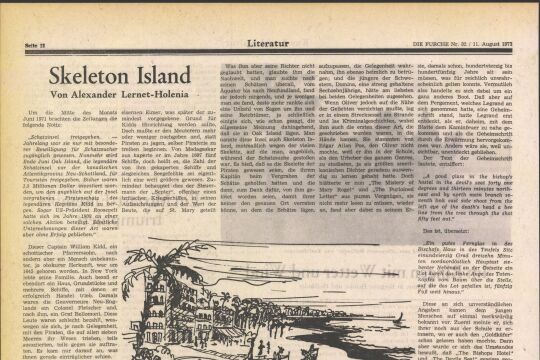Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Demontagen
Es erregte einige Verwunderung, daß bei den heurigen Berliner Filmfestspielen die amerikanische Produktion „Buffalo Bill und die Indianer“ den ersten Preis gewann; eine besondere Überraschung war es aber nicht, denn Regisseur Robert Altmann gehört seit seinem Erfolg „M. A. S. H.“ zur internationalen Elite seiner Sparte, und mit Stars spart der Film ebensowenig wie mit Ausstattung. Vielleicht hat auch die 200-Jahr-Feier der USA zu diesem Jury-Urteil ein wenig beigetragen. Dabei gibt der Film natürlich kein historisches Panorama der Vereinigten Staaten, er kratzt nur von der Geschichte des Wilden Westens etwas Goldstaub ab. Genauer gesagt: er demonstriert die Heldenlegende von Buffalo Bill, der sich als Erfindung eines Journalisten entpuppt und in einer Show die Mär um ihn darstellt, dabei aber von dem Indianerhäuptling Sitting Bull in einem stummen Auftritt demaskiert wird. Man unterhält sich zu Beginn noch gut über den ironischen Grundton des Films, verliert aber bald das Interesse an der allzu breit ausgewalzten Story, die man auch nicht so goutieren kann wie jemand, dem die Geschichte des Wilden Westens ein nationales Anliegen ist. Darstellerisch spielt diesmal Burt Lancaster seinen nicht minder prominenten Partner Paul Newman glatt an die Wand.
Kaum weniger spezifisch amerikanisch ist „Fahr zur Hölle, Liebling“, die Filmfassung von Raymond Chandlers Roman „Farewell, my lo-vely“. Hauptfigur ist wie üblich bei
dem Krimi-Autor der abgewirtschaftete, lässige Privatdetektiv Philip Marlowe, der froh ist, wenn er verschwundene Töchter aus gutem Haus aufstöbern kann, dann aber plötzlich einen größeren Auftrag bekommt: er soll die Frau eines Bankräubers, der sieben Jahre im Gefängnis verbracht hat, aufstöbern. Damit stößt er aber in ein Wespennest von Verbrechen verschiedener Art, aus denen er seine Haut nur mit Mühe retten kann. Der Film spielt Anfang der vierziger Jahre und kann dadurch ein bißchen auf der Nostalgiewelle mitplätschern. Er läßt in der Hauptfigur nicht nur trockenen Humor, sondern auch einige feinere menschliche Züge aufblitzen. Obendrein spielt Robert Mitchum den Privatdetektiv auf eine sehr sympathische, nonchalant-persiflierende Art; der Schauspieler, der seit mehr als dreißig Jahren „im Geschäft“ ist und heute zu den Hollywood-Veteranen zählt, bietet hier die vielleicht beste Laufbahn seiner Karriere. Schade, daß das Drehbuch, trotzdem die Figur Philip Marlowes zum Stehaufmännchen, ja zum Helden hochstilisiert ist, den Film nach einem infolge der Handlungswirren nachlassenden Spannungsbogen in eine primitive Killerei einmünden läßt.
Da die gräßliche Blutoper „Man-dingo“ ein weltweiter Kassenerfolg war, stand eine Fortsetzung zu befürchten. Sie präsentiert sich nun unter dem schönen Titel „Die Sklavenhölle der Mandingos“; das Schlußbild dieses zweiten Teils läßt obendrein vermuten, daß ein dritter unabwendbar sein wird. Die um 1820
in New Orleans und Umgebung angesiedelte Handlung stellt wieder einmal bestialische weiße Sklavenhändler (die bösesten sind Franzosen und homosexuell) den geschundenen, meist sehr stattlichen und edlen Negern gegenüber, die ihren „Masters“ als Arbeitstiere und vor allem als „Deckhengste“ zur Aufzucht der besonders gesuchten Man-dingo-Rasse dienen. Nachdem der Regisseur Steve Carver genügend Emotionen aufgeheizt und ein riesiges Schlachtfest inszeniert hat,
klingt der Streifen mit dem schönen rassistischen Satz „Die Schlimmsten sind die Mischlinge“ aus. Gespielt wird wie auf einer Provinzschmiere, was man am wenigsten dem „Helden“ Ken Norton ankreiden kann. Er ist von Beruf Schwergewichtsboxer und wurde seinerzeit durch einen Sieg über Oassius Clay berühmt, gegen den er übrigens in den nächsten Tagen wieder antreten wird.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!