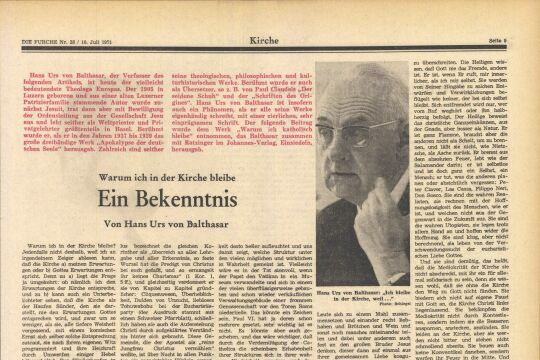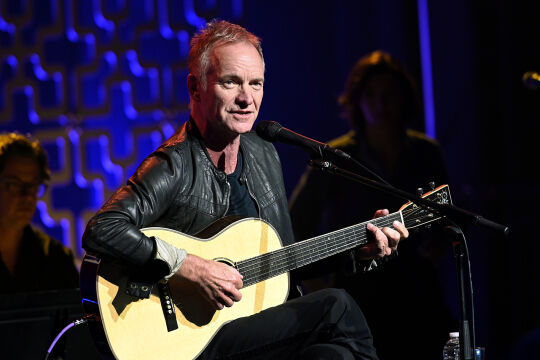Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der verrockte Jesus
„Lernt die Lektion!“ nennt sich ein Song aus dem Rock-Biblical „God-spell“. Robert Gilbert, der „My Fair Lady“ mit Schwung und Witz ins Deutsche übertragen hat, kommt diesmal nicht ohne verkrampftes Twen-Gebaren aus, wenn er einige frohe Botschaften mundgerecht verkünden will: „Jede dufte Story vom verheiß'nen Land sagt: Mensch, du schaffst es nur durch Energie. Lernst du alle zehn Gebote gut und gründlich, nützt es selten — schaden kann es nie!“
Dies scheint das geheime Motto des God-Rocks, des musikalischen Hippie-Evangeliums, in deutschen Landen zu sein: „Nützt es selten — schaden kann es nie.“ Also versuchen wir's doch einmal, dachte sich der Pfarrer katholischer oder evangelischer Konfession, und öffnete vor zehn Jahren Tür und Tor seines Gotteshauses den sogenannten neuen Liedern, die nun leider zumeist nichts anderes waren als ein armseliger Abklatsch von Schlager- und Spiritualtechnik. Also versuchen wir's doch einmal, denkt sich der Pfarrer, und macht heute einige theologische Klimmzüge, um der rockenden Gottesmusik den Einzug vor den Altar zu ermöglichen. Schaden kann es ja kaum, wie gesagt — was vielleicht aber doch noch die Frage ist —, und unter Umständen läßt sich die fröhlich-laute Kunde vom Heilsgeschehen gar noch für die Zwecke der Kirche nutzen.
Hauptpastor Hans-Jürgen Quest von der evangelischen St.-Michaelis-Kirche in Hamburg, in die nach der Premiere in St. Petri das Biblical „Godspell“ umgezogen ist, hat dazu im aufwendigen Programmheft, das ganz unfromm und ungeniert dem berühmten „Hair“-Plakat abgeschaut ist, folgendes zu sagen: „So hatten wir das Evangelium noch nie vor Augen. Die Spieler sind ein ausgelassener Haufen junger Leute, die in einem wahren Wirbel von Einfällen wesentliche Teile der Botschaft auf die Bühne bringen. Alles ist getragen von der großen Freude, daß die Zeit Gottes angebrochen ist. Man begreift im Banne dieser Darstellung zum ersten Male, was mit dem verblaßten Wort der Gotteskindschaft eigentlich gemeint ist. Und das gilt vor allem für den Jesus dieses Musicals. Er ist ein fröhlicher Bursche, der in
Gemeinschaft mit seinen Freunden In ausgelassener Spielfreude singend und tanzend, purzelbaumschlagend und steppend, auf die heiterste Weise Ernst macht damit, daß Gott gekommen ist, um sich seiner Menschen anzunehmen. Und man begreift auf einmal auch, warum sie alle, Jesus und seine Genossen, in Narrenkostümen auftreten. Gotteskindschaft ist die seligste Narretei, die sich denken läßt — für unser durch und durch verbürgerlichtes Denken. Aber so verfahren ist keiner von uns, daß bei ihm nicht die Sehnsucht erweckt werden könnte für jene Freiheit und Fröhlichkeit, die aus .Godspell' uns erfaßt.“ Man hat sehr viel Verständnis für diese munteren Purzelbäume eines Gottesmannes, wenn man bedenkt, welch merkwürdige Faszination für die Kirche von dieser Tatsache ausgehen muß: da kommt eine ganze Reihe von szenisch-musikalischen Gebilden übers Land geschwemmt, für die sich junge Leute sehr ernsthaft interessieren, und all diese Rock-Opern, Biblicals, Klangbibeln haben nun etwas mit Jesus zu tun. Diese musikalische Welle im Gefolge der religiösen Renaissance der Jesus People muß zwangsweise die Kirche auf den Plan rufen, wenn sie darin eine Möglichkeit sieht, junge Leute, die so begehrten, abseits von der Kirche stehenden jungen Leute, für sich zu gewinnen.
Jedoch: Die Kirchenschlager der sechziger Jahre haben nichts gefruchtet, weil nach einer gewissen Zeit des Modisch-Interessanten die musikalische Dürftigkeit der Versuche durchschaut war. Daß jetzt die Jesus-People-Bewegung zumindest in Deutschland von der zahlenmäßigen Stärke her nur sektiererisches Kleinformat hat, nicht mehr recht wächst und zudem zunehmend in das Fahrwasser von Show-Mechanismen gerät, stellt sich immer deutlicher heraus. Und schließlich: Was die besagten jungen Leute in Scharen zu den Jesus-Veroperungen gehen läßt, ist nicht die Botschaft, sondern das Transportmittel, die Musik nämlich, ist die Hoffnung auf ein vernünftiges Stück Rock und Pop, seitdem nach „Hair“ musikalisch kaum noch Bemerkenswertes auf die Szene gekommen ist. Da diese jungen Leute ein sehr genaues Gespür für die Qualität der Musik haben — ein genaueres jedenfalls als die Kirchenmänner —, muß man nicht unbedingt ein sehr begabter Prophet sein, um dem Jesus im Showgeschäft nur in einem Fall eine erfolgsträchtige Zukunft zu verheißen: In „Jesus Christ Superstar“.
Es wird viel vom Geschäft mit Jesus geredet, vom Jesus im Schau-geschäft, zumeist mit' abwertendem, moralisierendem Unterton. Mit Jesus sind immer Geschäfte gemacht worden, in Filmen ausgesprochen reichlich, und im strengen Sinne wäre heute auch jede Aufführung der Bachschen Matthäus-Passion ein Geschäft mit der Botschaft. Da Jesus momentan Mode ist, einfach „in“ ist, hätten Musikmanager eindeutig ihren Beruf verfehlt, wenn sie hier nicht Chancen für Gewinn wittern würden. Das eigentliche Geschäft mit Jesus jedoch beginnt erst da, wo die Kirche im Anschluß an den kommerzialisierten Musikbetrieb den Rock-Jesus theologisch vereinnahmen will.
Gelegenheit dazu bietet sich ausgiebig: Den Anfang machte die belgische Klangbibel „Glory Halleluja 2000“, ein kümmerlich-kitschiges, hymnisch-naives musikalisches Ge-mischtwarenprodukt. Es folgte die erste deutsche Jesus-Oper „Der Jesus-Pilz“, die zu allem musikalischen Ungemach auch noch textlichen Nonsens verbreitete. Im Abstand von acht Tagen hatten dann zwei amerikanisch-englische Produktionen in der deutschen Fassung ihre Premiere: das Biblical „Godspell“ von Schwartz/Tebelak in Hamburg und die Rock-Oper „Jesus Christ Superstar“ in Münster. Beide Unternehmungen sollen im nächsten halben Jahr auf Deutschlandtournee reichlich Geld in die Kassen bringen und die Produktionskosten von 480.000 beziehungsweise einer Million Mark wundersam vermehrt wieder einspielen, frei nach dem Hero-des-Song aus dem „Superstar“: „Jesus, nein, du ahnst es kaum, du bist der Hit seit Jahr'n — alle reden über dich, den Superwundermann.“
„Godspell“, was soviel heißt wie „Jesus beim Wort nehmen“ oder auch „Zauber Gottes“, schenkt uns den fröhlichen Jesus wieder, was im Hinblick auf die in Kirchen oft vergessene rechte Fröhlichkeit keine so schlechte Sache wäre, wenn es nicht die Munterkeit nach dem Motto „Einen Jux will er sich machen“ bedeutete. Im ersten Teil gibt
Jesus einer ausgelassenen Schar in Clownskostümen eine Unmenge von Gleichnissen zu verdauen; er verkauft seine Botschaft mit Zahnpastalächeln und Deodorantappeal, ist Jung-Siegfried und Sonny Boy, eine grinsende dufte Type, ein Superbaby, das mit seiinen lustigen Genossen Häschen in der Grube spielt. Hier werden sie nicht zu Kindern, sondern kindisch, nicht zu Narren, sondern zu Dümmlingen.
Der Bruch erfolgt natürlich im zweiten Teil, nachdem in der zum Theater aufbereiteten Kirche Sekt und Orangensaft die Pause füllten und eine in Abendkleid und Smoking aufmarschierte Musikkommerzschik-keria sich mit den Jüngern auf der
Bühne per Abendmahlswein aus“ Pappbechern verbrüdern konnte. Zu Abendmahl und Leidensgeschichte mußte man schon ernsthaft werden. Und siehe da: wie die Fröhlichkeit mißverstanden wurde, so rutschte auch der Ernst in Sentimentalität ab. Von der zwischen Kaffeehaus und nachgemachtem Rock angesiedelten Musik, die von einigen Anjublern populär gemacht werden sollte, lohnt sich nicht, zu reden.
Was bleibt, ist „Jesus Christ Superstar“, die Rock-Oper des Teams
Webber/Rice, die musikalisch alle anderen Jesus-Bemühungen um einige Klassen hinter sich läßt. Zur deutschen Erstaufführung in der Münsterlandhalle, szenisch wenig aufwendig, dafür in den Kostümen von hinreißender Qualität, begab sich Erstaunliches: der Jazzer Rolf Kühn, ein durchaus prominenter Mann in seinem Metier, heizte die Musik so sehr an, gab ihr soviel „drive“ mit, daß sie — bislang fast nur von der nicht ganz unsentimentalen amerikanischen Plattenaufnahme bekannt — plötzlich harte Rock-Akzente bekam, geradezu ekstatische Dimensionen erhielt. Natürlich könnte man auch hier noch puristische Vorbehalte anmelden: die Mischung von Folklore, Rock und Beat, von Bach und Bernstein, von Gershwin und Gospel ist ohne Zweifel ein buntes Allerlei und in den Rezitativen sehr harmlos — aber das wird alles so ehrlich gemixt, so unbändig zusammengewürfelt, daß das Ergebnis frappierende Musikalität enthält.
Der „Superstar“, eine perfekt cho-reographierte Show, eine auf vollen Touren laufende Revue, ist der unumschränkte Hit unter den Jesus-Musiken, die jungen Leute werden ihn mit Recht goutieren; die Musik macht es möglich, daß man selbst an szenisch „gefährlichen“ Stellen, etwa wenn Jesus zur Kreuzigung hydraulisch in die Hallenkuppel hochgehievt wird, stille hält. Und dieser „Superstar“ hat auch textlich das diskussionswerteste Buch zu bieten: hier ist Jesus ein Resignierender, der nicht recht weiß, warum das alles mit ihm geschieht, warum er in den Tod geht. Er ist der Zweifler, wie Petrus ein Vertreter des „Ich kenne ihn nicht“. Wenn überhaupt im Jesus-Geschäft theologische Ansatzpunkte liegen, so hier: in der Reflexion über die Kirche des Zweifeins.
Kein Zweifel aber: das Interesse am verrockten Jesus ist primär musikalisch. Das gute Geschäft machen die Musiker, nicht die Kirche. Für die fallen voraussichtlich höchstens ein paar Predigtthemen ab.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!