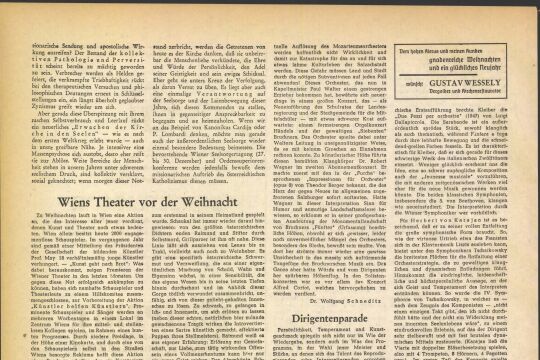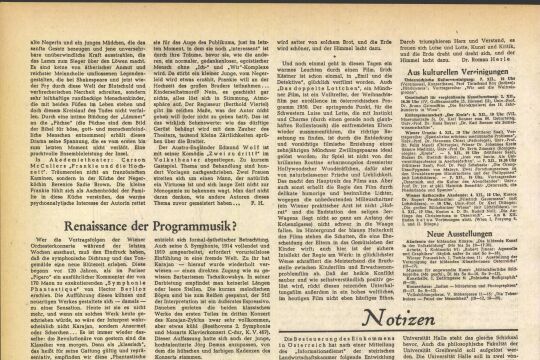Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Dirigentenkarriere
Man wird sich den Namen des jungen Russen, der in der „Großen Symphonie“ für David Oistrach einsprang gut merken müssen: Dmitrij Kitaenko, knapp über 30 Jahre, aus Leningrad gebürtig und nun am Anfang einer internationalen Karriere, hat bereits 1970 in Wien debütiert. 1967 hat er hier sogar studiert und 1969 in Berlin den Preis der Herbert-von-Karajan-Stiftung zuerkannt bekommen. Seither sammelt er in Moskau Musiktheatererfahrungen und dirigiert verschiedene große Orchester in Europa, Japan und Südamerika.
Er ist ein schlagtechnisch sehr sicherer, eher lyrisch gestimmter Künstler. Seine Markierungen wirken sachlich, zurückhaltend, aber man spürt, wieviel Kraft dahintersteckt, wenn er ein Orchester — hier die in Hochform musizierenden Symphoniker — im Laufe eines Konzerts in seinen Leistungen systematisch steigert. Ereignis der „Großen Symphonie“ war denn auch die letzte Programmnummer, Tsdiaikowskys „Sechste“, eine verhaltene, aber geschmacklich in der Wahl der Farben und der Intensität des Ausdrucks schön austarierte Wiedergabe. Kitaenko findet die richtige Mischung zwischen Tschaikowskys Theatralik und neurotischem Leiden, das ihn in Schwermut versinken läßt. Und Kitaenko steigert die Symphonie geschickt auf den strahlenden Höhepunkt, den Marsch, hin, um den Lamentoso-Satz um so breiter, erschütternder im Abgrund verdämmern zu lassen. Georgij Swiri-dows „Triptychon“, ein banales folkloristisches Stück von 1967, konnte auch er nicht aufwerten. In Proko-fjeios „Symphonie classique“ steckt mehr Witz und Charme als die Symphoniker diesmal anzubieten hatten.
Das „Budapester Kammerensemble“ unter Andras Mihaly hatte als Hauptprogrammpunkt seines Konzertes Schönbergs „Pierrot lunaire“ gewählt, jenes der expressionistischen Ära des Komponisten zuzurechnende Werk, das Gedichte Albert Girauds vertonend, in seiner Atona-lität als Vorstufe für die spätere Dodekaphonik Schönbergs anzusehen ist. Die auch heute für ein mit Schönbergs bereits oft konfrontiertes Publikum sich nicht leicht einstellende Perzeptionsfähigkeit für dieses Opus wird noch dadurch erschwert, daß der in eine Sprechstimme umgewandelte „Gesang“ der Solistin wohl der Tonhöhe und dem Rhythmus nach festgelegt ist, aber keinen gehaltenen Ton gestattet. Um den überaus schwierigen Solopart nahm sich Erika Sziklay als gewiß erprobte Kennerin an.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!