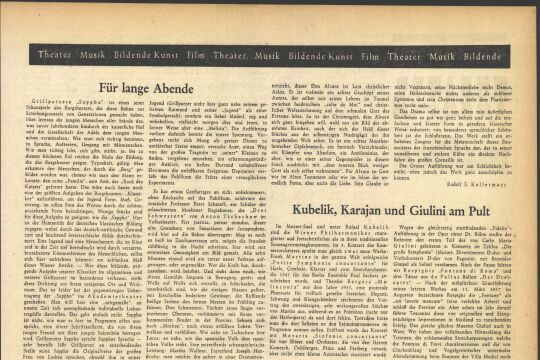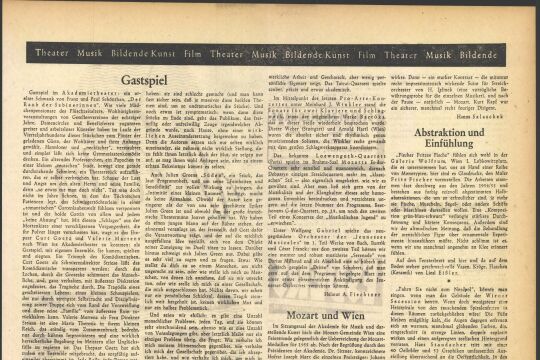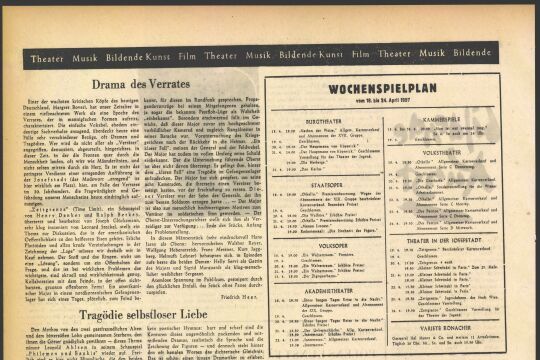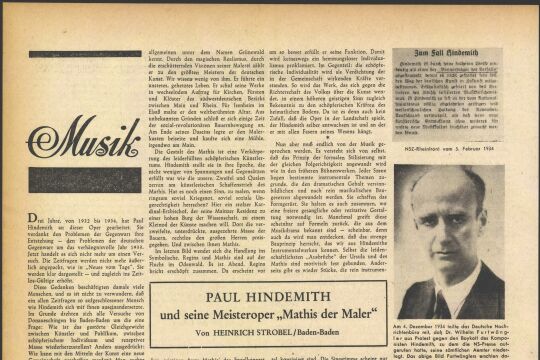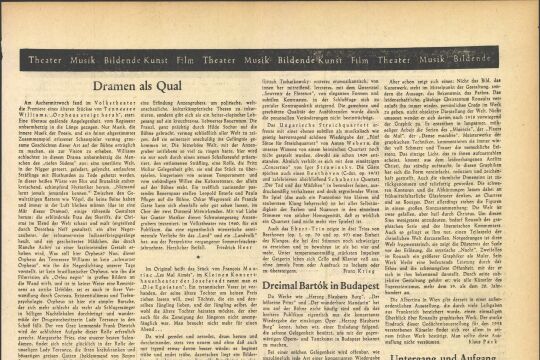Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Suite, Symphonie und Tongemälde
Die Vorläuferin unserer klassischen Symphonie ist die Suite, ursprünglich eine Folge motivisch unverknüpfter Tanzformen. Während der letzten fünfzig Jahre etwa ist eine gewisse Abkehr von der anspruchsvollen Form der großen Symphonie und ein Rückgriff auf die unverbindlichere Form der Suite zu beobachten. Der Meister der ungarischen Moderne, B £ 1 a B a r- t 6 k, schrieb 1923 seine „T a n z s u i t e”, die zwar vom ungarischen Volkstanz inspiriert ist, in der aber der Rhythmus so selbstherrlich vorherrscht, daß als Resultat nicht Tanzstücke entstehen, sondern Visionen des Tanzes in jenem abstrakten Stil, der auch die späteren Werke Bartoks charakterisiert. Der ständige Taktwechsel, die außerordentliche Kompliziertheit des rhythmischen Gefüges stellen an die Interpreten dieses Werkes sehr hohe Anforderungen, denen der ungarische Dirigent Janos Feren- csik nicht ganz gewachsen war. Im gleichen Konzert der Wiener Symphoniker hörten wir Debussys symphonische Skizzen „La Me r”, in welchen der Komponist unter Verzicht auf alle persönliche Selbstbespiegelung versucht, ein Stück Natur unmittelbar in Tönen wiederzugeben. Diese Partitur, eine der heikelsten und empfindlichsten der neuen Musik, muß der Dirigent Note für Note mit allen Lichtern, Nuancen und Zwischentönen im Kopf haben, und nur eine sehr leichte Hand vermag das „Spiel der Wellen” nachzuzeichnen. Der bekannte „Bolero” von Ravel beschloß das interessante, sehr geschickt komponierte Programm, in dessen Mittelpunkt das Violinkonzert von Brahms stand (Wolfgang Schneiderhan), über welches in anderem Zusammenhang berichtet werden wird.
Das 4. Philharmonische Konzert leitete Herbert von Karajan. Er war auch der Solist des nicht sehr stilecht bearbeiteten und übermäßig stark besetzten „Concerto da camera” von Locatelli (1695—1764). Nach einer wenig bekannten Symphonie von Mozart (K. V. 319, B-dur) erklang die 5. Symphonie von Tschaikowsky. Leidend und leidenschaftlich, sentimental und exaltiert, im Volkstümlichen wurzelnd, aber in die eigene Individualität völlig gebannt, ist dies Werk überaus charakteristisch für das ausgehende 19. Jahrhundert, zu dessen repräsentativen Künstlern Tschaikowsky zählt. Ob uns dieser Typus des Künstlers behagt oder nicht — jeder Widerstand schmilzt dahin in dem Glutatem ehrlicher, intensiver Empfindung und unter dem Eindruck der großen symphonischen Geste, welche vor allem die beiden Ecksätze der Symphonie beherrscht. Die formale Klarheit und ein sicher gestaltender Kunstverstand sind die Dämme, die diesen brausenden Strom von Musik mühsam in seinem Bett halten. Man kann bei der Interpretation Tschaikowskys mehr die westlich-gebändigte oder die halbasiatisch-ursprüngliche Komponente betonen. Karajan entschied sich bewußt für die letztere und ging in Ausdruck und Dynamik bis an die äußerste Grenze. Die Philharmoniker folgten ihm mit bewunderungswürdiger Einfühlung in diesen Stil und schenkten uns eine Aufführung von kaum Zu überbietender Intensität.
Im Russischen Symphoniekonzert folgte nach einer kleinen Suite von Kabalewsky (geb. 1904) „Die Komödianten”, und dem 2. Klavierkonzert von S. Rachmani- now (Solist Alfred Kitchin, London) die Erstaufführung der 2. Symphonie von Cha- tschaturian, dessen Violinkonzert und 1. Symphonie wir bereits kennen. Die leuchtenden Farben seiner orientalischen Heimat, die Rhythmen kaukasischer Volkstänze und die gefühlvolle Lyrik armenischer Volkslieder und Improvisatoren, der Aschugen, geben seinem Stil das Gepräge. Als Bereicherung empfinden wir einen neuen Aspekt des Orientalischen, den uns Chatschaturians Tongemälde vermittelt. Mit unserer westlichen Symphonie hat das neue Opus des armenischen Komponisten allerdings wenig gemein. Bei der russischen Uraufführung der 2. Symphonie hatte die Kritik auf gewisse Fehler des dramaturgischen Planes und auf die übermäßig starke Verwendung der, Ausdrucksmittel des Orchesters hingewiesen. Das trifft vor allem auf die beiden Ecksätze des Werkes zu. Bemerkenswert aber ist vor allem der dritte Teil des Werkes: ein großangelegter und mächtig gesteigerter Trauermarsch, dessen mittlerer Teil von der sehr streng und ernst vorgetragenen Melodie des „Dies irae” gebildet wird. Die Wiener Symphoniker unter Rudolf Moralt boten mit der Interpretation dieses schwierigen und weitläufigen Werkes eine ganz ausgezeichnete Leistung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!