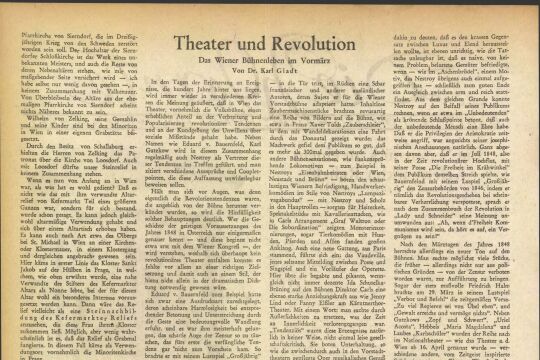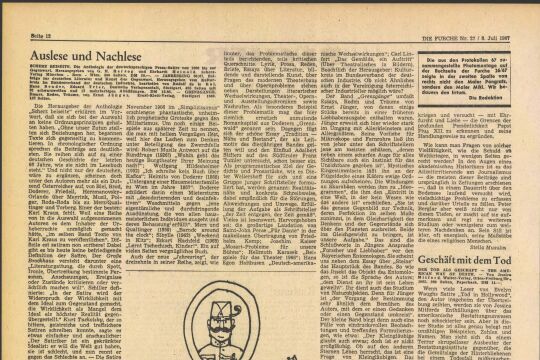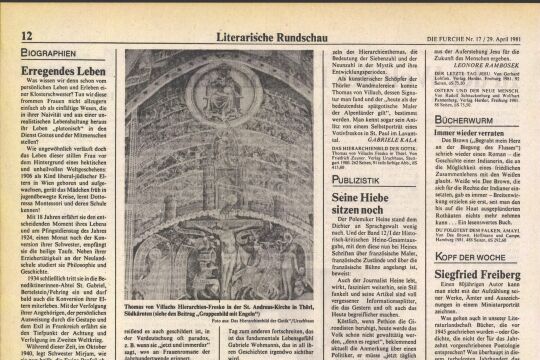Heinrich Heine — und keine Folgen
Vor etlichen Wochen erst gab es wieder Streit um Heine. Im Hin und Her der Meinungen konnte man sich nicht einigen, ob die Universität in Düsseldorf künftighin Heinrich-Heine-Universität heißen sollte. Vielzitiert wurde das Wort eines weißhaarigen Herrn, der beim Düsseldorfer Heine-Hearing erregt aufsprang und rief: „Ja wissen Sie denn nicht, wer Heine ist?“ Eine mehr als symptomatische Frage. — Es scheint, daß Liebe und Haß. Hochmut und Borniertheit, Mißtrauen und Mißverständnis, unentwirrbar ineinander verstrickt, eine Tzwischen Heine und den Deutschen errichtet haben. Hundert Jahre lang hat man ihn mit schlechtem Gewissen gepriesen oder mit nicht besserem geschmäht. Zwölf Jahre lang hat man dann versucht, ihn totzuschweigen. Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren redet man wieder über ihn, mit schlechtem Gewissen und manchmal peinlicher Beflissenheit; doch das Gerede hat ihn nicht zu neuem Leben erweckt. Heine liegt den Deutschen nicht, denn er ist unbequem und anstrengend. Er ist Literat und Artist zugleich.
Vor etlichen Wochen erst gab es wieder Streit um Heine. Im Hin und Her der Meinungen konnte man sich nicht einigen, ob die Universität in Düsseldorf künftighin Heinrich-Heine-Universität heißen sollte. Vielzitiert wurde das Wort eines weißhaarigen Herrn, der beim Düsseldorfer Heine-Hearing erregt aufsprang und rief: „Ja wissen Sie denn nicht, wer Heine ist?“ Eine mehr als symptomatische Frage. — Es scheint, daß Liebe und Haß. Hochmut und Borniertheit, Mißtrauen und Mißverständnis, unentwirrbar ineinander verstrickt, eine Tzwischen Heine und den Deutschen errichtet haben. Hundert Jahre lang hat man ihn mit schlechtem Gewissen gepriesen oder mit nicht besserem geschmäht. Zwölf Jahre lang hat man dann versucht, ihn totzuschweigen. Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren redet man wieder über ihn, mit schlechtem Gewissen und manchmal peinlicher Beflissenheit; doch das Gerede hat ihn nicht zu neuem Leben erweckt. Heine liegt den Deutschen nicht, denn er ist unbequem und anstrengend. Er ist Literat und Artist zugleich.
Die Geschichte der deutschen Heine-Denkmäler ist die politische Geschichte der letzten hundert Jahre. Die jahrzehntealte Tragikomödie „Das Heine-Denkmal in Düsseldorf“ (oder Mainz oder Hamburg oder Frankfurt oder auf Korfu) bezeichnet nicht nur sein politisches, späterhin „rassisches“ Schicksal — sondern die Essenz seines Wesens. Sein Genius schillert vor extremer Widersprüchlichkeit. Noch heute kann er es keinem recht machen. Vielleicht liegt es daran, daß er zwischen den Lagern stand, „ein Deutscher... auf den sich der Deutsche nicht berufen kann“, weder der von gestern noch der von heute.
In Toulon steht das Heine-Denkmal, das ursprünglich der Kaiserin Elisabeth gehörte. Die Heine-Enthusiastin hatte es im Park ihres Schlosses auf Korfu aufstellen lassen. Als nach Elisabeths Tod Kaiser Wilhelm II. das Achilleion erwarb, störte ihn das Denkmal des Poeten, der den Hohenzollern nachgesagt hatte, sie stammten von Pferden ab. Er verkaufte es einem Nachkommen des Buchhändlers Campe, des Heine-Verlegers, für 10.000 Mark. Der wollte es der Stadt Hamburg schenken, die es jedoch ablehnte. Schließlich wurde es im Hof des Buchhändler-Börsenvereins aufgestellt, wo das weiße Marmormonument wiederholt von antisemitischen Kommis mit roter Tinte beschmiert wurde. Dann vertrauerte es Jahrzehnte unter einer Bretterhaube und wurde nach 1933 in ein Magazin übergeführt, wo es neben einem zweiten Heine-Denkmal zu stehen kam. Wie dann das Korfu-Denkmal nach dem Krieg eigentlich nach Frankreich gekommen ist, blieb ungeklärt.
Es dürfte auch im Heine-Gedenkjahr schwerfallen, dem Dichter wieder Heimatrecht zu geben. Wiederholte Rundfunkumfragen oder Erkundungen bei der Schuljugend (selbst in Düsseldorf angesichts des noch halbwegs erhaltenen Geburtshauses) ergaben erschreckende Unwissenheit. Gerade noch, daß man den Namen kannte. In Frankreich und in England lernte seit hundert Jahren jedes Kind, daß Heine als der große Lyriker Deutschlands nach und neben Goethe gelte. Die deutschen Kinder hörten nichts davon, und sie werden es nicht hören, bis es zu spät ist; denn bald ist es nicht mehr wahr. Das Urteil über Heines Goethe-Nähe versteht sich heute nicht mehr ohne weiteres.
Auffallend der Wandel in der Einschätzung eines Dichters: ein glanzvoller, alle Ablehnung, ja sogar Haß überstrahlender Ruhm Verdunkelt sich nicht nur, sondern schwindet völlig. Der Lyriker Heine war der Lieblindsdichter der deutschen bürgerlichen Gesellschaft bis in unser Jahrhundert hinein. Kaum von einem anderen Dichter waren so viele Gedichte so vielen Menschen geläufig, wozu noch die Vertonungen beitrugen. „Loreley“, „Die Grenadiere“, „Belsazar“, „Wallfahrt nach Kevelaer“ standen in jedem Schullesebuch, andere Heine-Gedichte in volkstümlichen Anthologien. Im Dritten Reich war er freilich verpönt, sein Name ausradiert: In Bartels Literaturgeschichte hieß er „Chaim Bückeburg“ und unter der „Loreley“ stand in den Schulbüchern: Ein Volkslied. Auch Hofmannsthal, um nur einen besonders prominenten unter den unliebsamen Namen
zu nennen, verschwand nach 1933 von den Bühnen und aus den öffentlichen Bibliotheken. Doch nach 1945 begann für ihn eine wahre Renaissance. Für Heine ist sie nicht gekommen, nicht einmal, als der äußere Anlaß sich einstellte: die 100. Wiederkehr seines Todestages (1956).
Der junge Harry Heine dichtete wie die anderen vaterländischen Barden — die Schenkendorf, Gleim, Fouque und sonstigen. Seine roman-tisch-idealisierenden Verse widerhallten nur so von Vaterland, Minne und Mittelalter, bis eine unglückliche Jugendliebe diese Scheinwelt zunichte machte. Sein Leben lang hat er an dem „unheilbaren Herzeleid“, an der Melancholie der nie überwundenen Enttäuschung aus seiner Jugendzeit getragen. Mühelos eignete sich sein Formtalent jede lyrische Technik an und erprobte die sprachlichen Möglichkeiten seiner Zeit. Das Volkslied in der Prägung des „Wunderhorns“ zog ihn an. Er hieß sich selbst den „letzten Fabelkönig der Romantik“, seinen „Atta Troll“ das „letzte Waldlied der Romantik“. Er schrieb: „Mit mir ist die alte lyrische Schule der Deutschen geschlossen, während zugleich die neue Schule, die moderne deutsche Lyrik von mir eröffnet wurde.“ Heine meinte damit die neue, Entwicklungen, Spannungen und Widersprüche der gesamten Lebenswirklichkeit einbeziehende, engagierte Kunst, die er der zweckfreien, wirklichkeitsfernen, von dem Glauben an eine naturgegebene harmonische Weltordnung beherrschten Kunstauffassung gegenüberstellte. Formal erreichte die romantische Poesie in Heines Lyrik den Höhepunkt und wurde dann durch bewußtes Überdrehen der Möglichkeiten von ihm parodiert und ironisiert. Helle Bewußtheit und Reflexion in Form von Ironie, Witz und Desillu-sionierung kennzeichnen seine Gedichte. „Ich stehe auf des Berges Spitze / und werde sentimental“,
heißt es, die romantische Stimmung parodierend, bereits im „Buch der Lieder“.
Das war die Dichtungsweise der „neuen Kunst“, die, nach Heines Prophezeiung, „in begeistertem Einklang“ mit der „neuen Zeit“ stehen werde. Er war skeptisch gegenüber einer reinen, glatten lyrischen Form in einer von Profit und Nützlichkeitsdenken beherrschten Welt. „Es will mich bedünken, als sei in schönen Versen allzu viel gelogen worden.“ Deshalb vermischte er die Lyrik mit Elementen der Prosa, des im nüchternen Sprechton Gesagten, der Sprache des Alltags, die, wie es schon in der römischen Kunstlehre heißt, „zu Fuß geht“, zum Unterschied von der dichterischen Hochsprache. Darum vermied er auch in dem von ihm bevorzugten Ton der Ironie jegliche Pathetik, ausgenommen das Pathos der Revolution.
Der Weg der drei großen Gedichtsammlungen: Buch der Lieder, Neue Gedichte, Romanzero führt von der spielerischen Ironie zum „tiefernsten Humor“. Ihr ungleichwertiger Rang — neben Bewunderswertem, erstaunlich Geprägtem findet sich immer wieder dürftig Gereimtes, gewollt Arrangiertes — provozierte die Frage nach Heines Dichtertum. Echtes, Ursprüngliches sollte nur der in extremer und elementarer Situation entstandenen Dichtung — „Romanzero“ und die letzten Gedichte — aus der „Matratzengruft“ zugestanden werden; bei der übrigen Lyrik könnte es sich eher um hochbefähigtes, geniales Dilettantentum des großen Prosaisten Heine handeln. Schon die Zeitgenossen sahen in ihm vorrangig den Schriftsteller von Originalität und außerordentlichem, vielseitigem Können, den glänzenden Essayisten, dessen scharfe Sicht und politisches Urteilsvermögen faszinierten. Was hat Heine nicht alles — auf nicht immer legitimen Wegen — an Materie an sich gerissen, blitzhaft durchschaut und durchleuchtet! In einer
geschmeidig mondänen, von Brillanz „besessenen“ Sprache — die er dann dem Polemiker Nietzsche, dem Briefschreiber Fontane, dem Redner Bismarck, dem Essayisten Thomas Mann als modernes Wort-Instrument hinterlassen konnte.
Aber schon Heine selbst hat sich gegen eine solche Zweiteilung ausgesprochen. „Bemerken muß ich jedoch, daß meine poetischen, ebenso gut wie meine politischen, theologischen und philosophischen Schriften einem und demselben Gedanken entsprossen sind, und daß man die einen nicht verdammen darf, ohne den andern Beifall zu entziehen“ (aus der Vorrede zum „Buch der Lieder“). Tatsächlich begleiten Gedichte in loser Folge seine Arbeiten in Prosa. Am Ende seines Lebens liegt ein vorwiegend lyrisches Verswerk von gewaltigem Umfang vor. Die Äußerungen des Todkranken bestanden nur noch in Gedichten. Alles das spricht gegen den Versuch, die Beschäftigung mit Heine auf seine Prosa zu beschränken. Ohne Kenntnis seiner lyrischen Dichtung, ohne ein Verhältnis zu ihr, läßt sich seine Gestalt nicht fassen.
Zu allen Vorurteilen und Abneigungen gegen Heine waren neu hinzugekommen: das Mißtrauen gegen den Künstler und der Vorwurf der Unseriosität. Das ging — vor allem bei den „Gebildeten unter seinen Verächtern“ — auf die Kritik von Karl Kraus in seinem Essay „Heine und die Folgen“ (1910) und in zahlreichen „Fackel“-Beiträgen zurück. Kraus meinte, er hätte darin „nicht Heine erledigt, aber mehr“. Das Niveau Heines war für ihn der „Feuilletonismus“. „Ohne Heine kein Feuilleton. Das ist die Franzosenkrankheit, die er uns eingeschleppt hat.“ Kraus verstand unter Feuilleton eine Schreibweise, in der Kunst und Leben, Dichtung und Information (für Kraus scharf zu trennende Bereiche) sich gefährlich vermengten. Feuilletonstil bedeutete ihm den Tiefpunkt des Sprachverfalles, das sichere Zeichen für einen unaufhaltsamen Kulturniedergang. Heine galt ihm als der eigentlichen Urheber, denn die rührigen Nachahmer seiner Prosa als Mischform von dichterischen und publizistischen Elementen schleppten sie als „Zerrbild journalistischer Verkommenheit“ in die von Kraus so gehaßte „mercantile Meinungspresse“ ein.
Es ging Karl Kraus zunächst weniger um eine literaturkritische, ästhetische Beschäftigung mit Heines Werk als vielmehr um die Auseinandersetzung mit dem Literaturbetrieb um Heine, namentlich in jüdisch-liberalen Kreisen, den Kraus als unerträglich empfand. Als die „Wiener Freisinnigen“ anläßlich der Enthüllung eines Heine-Denkmals auf dem Montmartre einen namhaften Betrag sammeln konnten, bezeichnete Kraus die Kranzniederlegung als „Grabschändung“. „Die beschämende Denkmalsbettelei“ im philosemitischen Lager erschien Kraus verabscheuungswürdiger als
„die Anpöbelung eines antisemitischen Trottels“. 1915 erreichte die Heine-Diskussion mit einem 40seiti-gen Aufsatz in der „Fackel“ in zwei Teilen unter den Überschriften „Die Feinde Goethe und Heine“, „Die Freunde Heine und Rothschild“ den bisher höchsten Grad an Schärfe. Kraus erweiterte seine ästhetische Kritik an Heine zur moralischen Verurteilung. An Hand von geschickt ausgewählten Zitaten aus dem Briefwechsel Heines mit seinem Bruder Gustav versuchte Kraus, den Briefschreiber Heine als „charakterlos“ zu überführen und rügte den „schmalzigen Familienton“ in den Briefen. Heine sei „ein Talent, weil kein Charakter“; mit Goethe verglichen, erweise sich seine ganze menschliche Erbärmlichkeit, bewiesen durch „Schmutzigkeiten und Schiebereien“ in seinen Briefen. Da aber die moralische Integrität eines Menschen die Voraussetzung jeder Kunst sei, werde mit Heines Charakterlosigkeit auch dessen dichterische Unfähigkeit erwiesen.
Es wimmelte dann bei Kraus nur noch so von Invektiven, wie „Heines Seichtheit“ und „Klapperstrophen“, denn dieser „Spottvogel“ betreibe nur „Handel mit dem Gefühl“. Dieser „prompte Bekleider vorhandener Stimmungen“ habe „der deutschen Sprache so sehr das Mieder gelockert ..., daß heute alle Kommis an ihren Brüsten fingern können“. Wenn dann noch das „Buch der Lieder“ als das „Hauptbuch der Firma Heine“ bezeichnet wird, überrascht einen dann auch nicht mehr der Kalauer: „Heine ist ein Moses, der mit dem Stab auf den Felsen der deutschen Sprache schlug (...) und es war Eau de Cologne.“ Karl Kraus erfaßte nicht Heines menschliche und künstlerische Problematik, seine durch das äußere Schicksal bedingte Zerrissenheit: politischer Emigrant und aus dem Deutschtum ausgestoßener Jude. Man wird den Verdacht nicht los, daß Kraus sich des Stoffes Heine nur bediente, um das aphoristische Feuerwerk seiner verabsolutierten Sprachkritik vorzuführen.
Heine schrieb: „Indessen, es gibt Herzen, worin Scherz und Ernst, Böses und Heiliges, Glut und Kälte sich so abenteuerlich verbinden, daß es schwer wird, darüber zu urteilen.“ Heine war gewiß eine komplizierte Natur, der besser über sich Bescheid gewußt hat als alle seine Zeitgenossen. Auch die Nachlebenden sind mit seiner Erscheinung und seinem Wirken nicht fertig geworden. Ein Eindruck bleibt nach der Beschäftigung mit dem kaum übersehbaren Werk: Die existentiell erregende Gestalt fesselt fast mehr und länger als das Werk. Dabei kann die Person von diesem gar nicht abgetrennt werden, und sie wird in seinen Schriften lebendiger, eigentlicher und wohl auch gewinnender als in seinen Briefen. Vor dem Urteil der Geschichte aber wird Heinrich Heine als Dichter und Schriftsteller bestehen, der nicht nur dem „Zeitgeist“, sondern dem Geist überhaupt verpflichtet war.