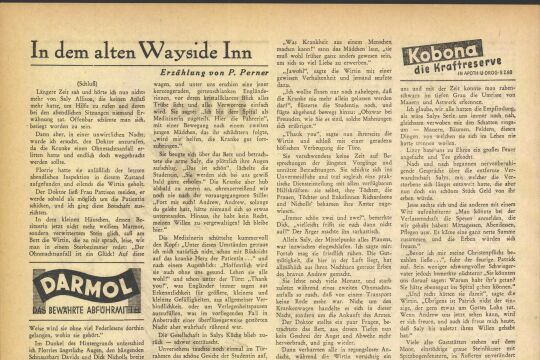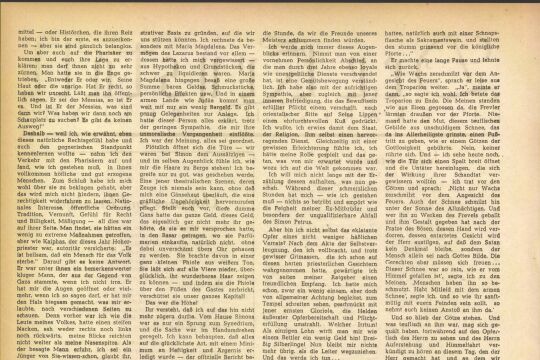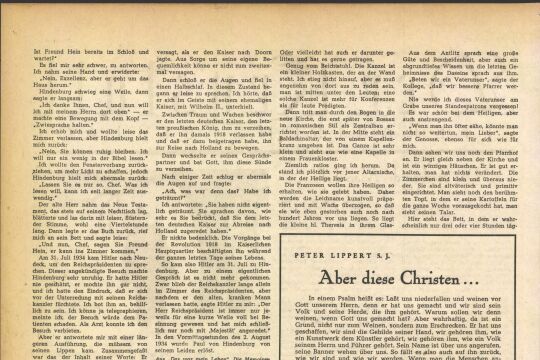Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Kein Wunder, daß… ?“
Kein Wunder, sagen sie, daß das schlecht gebaute Haus eingestürzt ist - ja was haben sie denn erwartet? Wäre es ein Wunder gewesen, wenn es stehen geblieben wäre? Wäre es als das empfunden worden? Aber ganz gewiß nicht. Keiner hätte von Wunder gesprochen, schon deshalb nicht, weil man längst nicht mehr an Wunder glaubt, es ist ja alles so erklärlich und natürlich. Etwa auch das, was . im folgenden in strenger Einhaltung der Wahrheit berichtet wird:
Als sich ein Skiläufer nach eifrigem Training am Lift zufrieden und besonnt, an den Mittagstisch setzte, mußte er eine arge Entdeckung machen: sein Siegelring hatte den blauen Stein mit dem Monogramm eingebüßt. Und das am 50. Geburtstag des Ringträgers! Der Ring war ein Maturageschenk seines verstorbenen Vaters gewesen.
Die Seelenlage dės Geburtstagskindes läßt sich ermessen. Überraschend hingegen war sein Entschluß, nach dem blauen Lapislazuli zu suchen. Eine
Stecknadel in einem Heuhaufen wäre wohl leichter zu finden gewesen, zumal, da der von der Hand erwärmte Stein ohne Frage im Schnee versunken war.
Nun, der Mann bewahrte die fruchtbare Beharrung des Skeptikers, eilte auf die Piste, stieg einige Meter hoch und sah sich einem leuchtenden, linsengroßen Blau gegenüber.
Derselbe Mensch erlebte Jahre später dies in Hinterstoder: Als er nach einem Schneesonnentag das reizende Kirchlein betrat und sich in einer der Bänke niederließ, was sah er vor sich liegen? Nun, ein Marienbild, gewiß nichts Besonderes, man könnte fast sagen, „kein Wunder, daß dort eines lag“.
Nein, kein Wunder. Oder doch? Ein horrender Zufall? Jedenfalls, das Bildchen zeigte die Madonna von Maria Plain, von der Basilika, rund 150 Kilometer westlich von hier entfernt, oberhalb von Salzburg gelegen, die dem Skifahrer von Jugend auf Begleiterin gewesen war.
Wie das Blättchen mit dem vertrauten Bild von dort hierher gewandert und so lange liegen geblieben war, - von keinem beachtet oder mitgenommen - bis er es zu Gesicht bekam, und wieso er einem spontanen Impuls folgend nach
der Skitour das Kirchlein betreten hatte, das alles läßt sich mit den nötigen geistigen Verrenkungen vielleicht rational erklären. Kein Wunder, sagen sie.
Aber, noch einmal der Skifahrer, diesmal als städtischer Zivilist, Jahrzehnte später, ein älterer Herr. Sonderbarerweise wieder eine Kirche im Spiel, der Gute ging nämlich jeden Sonntag zur Messe. Dies nun auch in der Anna- kirche in Wien.
Er war vor kurzem in seiner Heimat gewesen und hatte im altervertrauten Wirtshaus seiner Frau von dem liebenswerten Wirt erzählt, der ihm, als er 1944 in den Krieg abmarschierte, noch eine Wurst ohne Fleischmarken zugesteckt hatte.
Merkwürdige Koinzidenz: Wieder spielte ein Bildchen die Hauptrolle, diesmal eines jener Gcdenkblättchen, die man zur Erinnerung nach einem Todesfall an die Freunde ausgibt. Solche Bildchen wurden vor fünfundzwanzig Jahren auch ausgegeben, als der Wirt gestorben war.
Und ein solches Bildchen aus dem fernen Salzburgischen fand der nun in Wien Lebende in dem vor ihm liegenden Gebetstbuch.
Wunder? Aber nein. Aber.auch nicht „kein Wunder, daß …“ Man muß den Redensarten doch wohl näher ins Gesicht sehen. Schon Karl Kraus hat un; geraten: Je näher man ein Wort ansieht, umso ferner blickt es zurück.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!