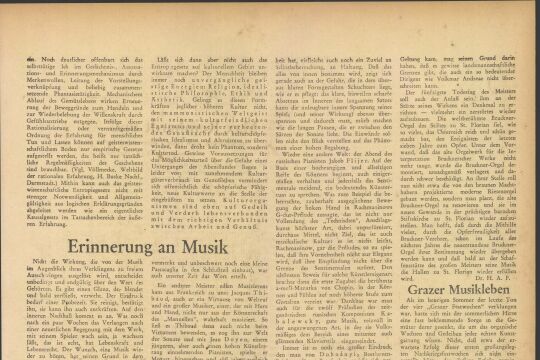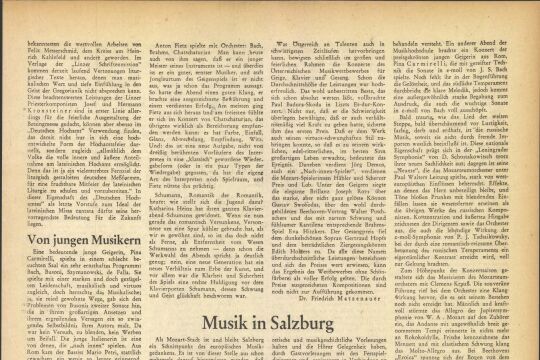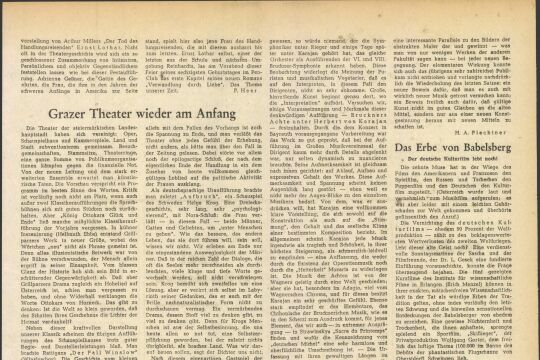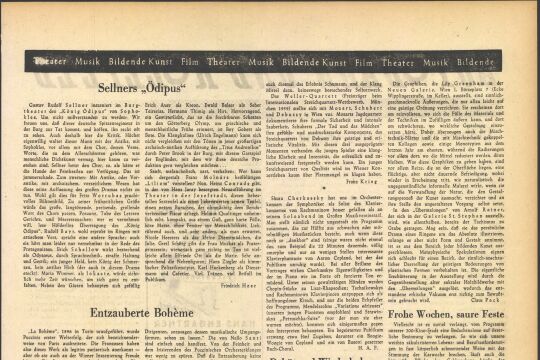Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Konzerte
Miriam Fried - geborene Rumänin, aber in Israel aufgewachsen und ausgebildet - holte sich wie viele junge Geiger unserer Zeit ihren letzten Schliff an der New Yorker Juilliard School of Music. 1974 debütierte sie im Konzerthaus, und sie kam wieder und ist bei uns bereits so beliebt, daß sie nun wieder im Großen Saal - im Zyklus „Meistersolisten” einen Sonatenabend geben konnte.
Freilich, sehr „meisterlich” ging es am Anfang gerade nicht zu. Der Grund unseres Unbehagens war die oberflächliche und auch technisch nicht befriedigende Wiedergabe einer Mozart-Sonate (B-Dur, KV 378). Die ehrgeizige Künstlerin dürfte wohl einen virtuosen Effekt angestrebt haben, um an dieser technisch doch eher schlichten Musik um so deutlicher ihre geigerischen Qualitäten demonstrieren zu können. Das Gegenteil aber war der Fall: verwischte Läufe und einige wenig schöne Stellen mit dem Bogen stellten der Künstlerin hier nicht einmal im Handwerklichen das beste Zeugnis aus.
Wesentlich besser gelang ihr Ravels einzige Sonate für Violine und Klavier. Man hatte den Eindruck, daß Miriam Fried es sich hier eher gestattete, ihr Temperament auszuleben, wenngleich eine gewisse kühle Distanz noch immer zu bemerken war. Das sensible, ja nervöse Irisieren im Ton, das für den Vortrag dieser G-Dur-Sonate so nötig ist, stellte sich nicht ein.
Dafür konnte man nach der Pause eine überzeugend schöne Wiedergabe der d-Moll-Sonate von Johannes Brahms erleben. Das Temperament konnte sich voll entfalten, ohne daß aber die Geige je zigeunerhaft gewirkt hätte, der Ton war flexibel - vom gläsern Gehauchten bis zum voll tönenden, warm durchvibrierten Gesang auf der G-Saite - die Technik wurde souverän gehandhabt. Da außerdem Homero Franceschi (er hat Frau Fried bereits einmal in Wien begleitet, sein Debüt als Solist beging er hier 1973 mit Bartöks erstem Klavierkonzert) wesentlich mehr war als nur ein stichwortbringender „Begleiter”, rundete sich der Abend im Konzerthaus doch noch zum großen Erlebnis.
Zu einem Kunstgenuß wurde der jüngste Liederabend von Peter Schreier im Brahms-Saal. Man darf wohl ohne jede Übertreibung sagen, daß der in Wien schon seit vielen Jahren beliebte Tenor in seinem Fach des lyrischen deutschen Liedes unübertroffen geblieben ist. Zu rühmen ist immer noch die ganz vorne „sitzende”, helle, leicht ansprechende Stimme, die beispielhafte Legatotechnik, und eine Deklamation, die einem Wiener Burgschauspieler (der älteren Schule) zur Ehre gereicht hätte. Daß sich dazu hohe Musikalität und ein wacher Verstand gesellen, spürt man bei jedem Auftritt dieses Belkanto- genies, sei es im Rahmen eines Liederabends, sei es im Dienste eines Oratoriums. Daß Peter Schreier die Musik unserer Zeit gerne ausklammert, das hat man ihm manchmal (leise) zum Vorwurf gemacht, doch wenn er dann „seinen” Schubert, oder, wie diesmal, Beethoven und Schumann singt, empfindet man Beglückung, daß es diesen Wundermann des Liedgesanges gibt. Mit „Adelaide” begann er, mit dem Liederkreis „An die ferne Geliebte” erreichte er den Gipfel seiner Kunst („Nimm sie denn hin, diese Lieder”) und erfreute sein Publikum bis zu Schumanns „Nußbaum” und „Romanze” mit scheinbar mühelosem, direkt aus der Eingebung des Komponisten herkommenden Gesang. „Flügelmann” Erik Werba, der nicht nur sein Klavierspiel, sondern sein ganzes Wissen um das Lied in den Dienst der Sache stellte, hatte am nicht endenwollenden Beifall Anteil.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!