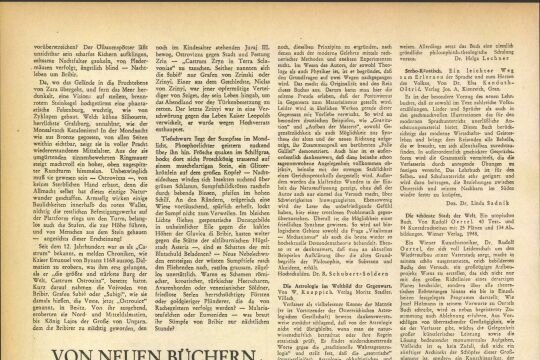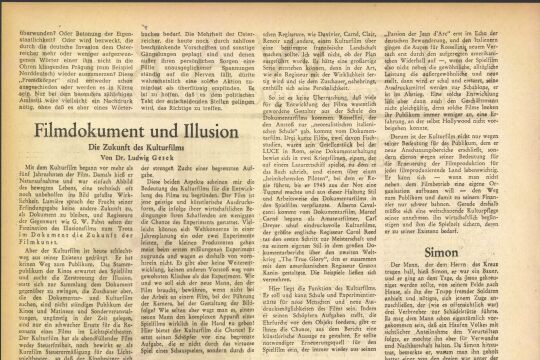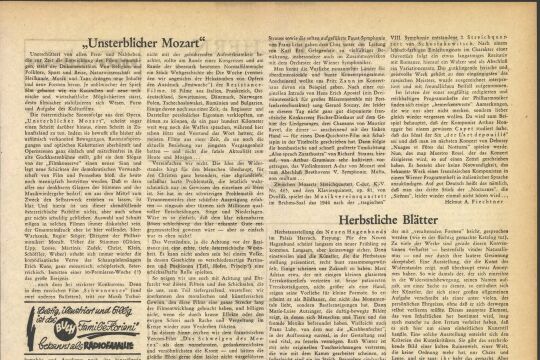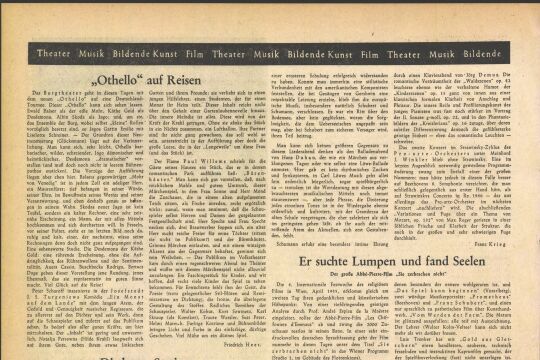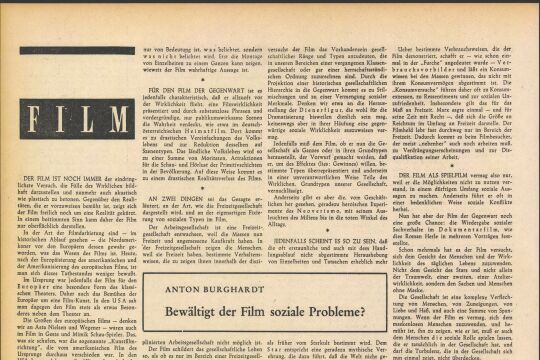Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Mißlungenes Experiment
„Dieser Film ist eine Art Anthologie über Wien seit der Erfindung des Films bis zur Gegenwart. Der Film enthält keinerlei Kommentar. Er ist eine Collage verschiedenartigen Materials, welches dem Zuschauer ein distanziertes Wien-Büd vermitteln will.“ Zu dieser Definition und Charakteristik, die Ernst Schmidt jun. seinem ersten abendfüllenden Film „Wienfilm 1896-1976“ voranstellt, könnte man sich noch verstehen. Er reiht nicht weniger als 130 verschiedene Bildsequenzen, zwischen einer Sekunde und sechs Minuten lang, aneinander und vermittelt so ein Kaleidoskop von alten Archivaufnahmen, gestellten Spielszenen, meist verkrampft-skurrilen Humorversuchen und durch Wiederholung bis zum Überdruß enervierenden Passantenbefragungen zum Thema „Wem gehört Wien?“.
Da der Autor seit 1963 eine Unzahl experimenteller Kurzfilme gedreht hat, war von ihm auch hier eine sehr eigenwillige Büderfolge zu erwarten. Nur bedeuten verwak-kelte, unscharfe, farblich schlechte Aufnahmen, oft im Zeitraffertempo geboten, mit schlechtem Ton unterlegt, noch keine unkonventionelle Kreativität oder gar künstlerische Avantgarde. Wenn die Vernachlässigung auch nur der geringsten technischen Perfektion hier sicher ein bewußtes Stilmittel ist, führt es über die Dauer von zwei Stunden nur zur Augen- und Nervenpein und zur Langeweile und nicht zur Erhellung eines vielleicht hintergründigen Sinngehalts.
So bleibt das Interesse des Beschauers am ehesten auf die politische Dokumentation aus den Jahren 1934 bis 1938 sowie russische Wochenschauaufnahmen von 1945 konzentriert. Etwas vom Witz, der das ganze Experiment erst schmackhaft gemacht hätte, besitzen nur etliche Armin-Berg-Schlager aus den Jahren zwischen 1929 und 1937.
Zu den wenigen deutschen Filmen, die in größeren Zeitintervallen immer wieder auftauchen und denen man auch noch 35 Jahre nach ihrer Herstellung mit uneingeschränktem Vergnügen begegnet, gehört Josef von Bakys „Münchhausen“. Es liegt nunmehr eine bildlich, vor allem in der Farbnuan-cierung verbesserte Fassung vor, die gelegentlichen tontechnischen Schwächen nimmt man angesichts der Gesamtqualität des Films nicht krumm. Denn die phantastischen Abenteuer des „Lügenbarons“ mit Zarin Katharina IL, sein Ritt auf der Kanonenkugel in die Fänge eines skurril-grausamen Sultans, sein Duell in Venedig wegen einer schönen Frau find schließlich, von dort, die Flucht auf den Mond mittels Ballon hat kein Geringerer als Erich Kästner geschrieben, damals allerdings - er hatte in der NS-Zeit Berufsverbot - unter Pseudonym. Hier hat ein Autor von Rang Humor, Esprit, Elan, aber auch etwas Poesie und Lebensphilosophie einem nach wie vor köstlichen, einfallsreich inszenierten und mit einer aufwendigen Dekoration ebenso wie mit einer Traumbesetzung ausgestatteten Füm zugrundegelegt. Und der Streifen besitzt -in den Szenen mit Zarin Katharina-auch etwas, was dem deutschen Film längst abhanden gokommen ist: subtile Erotik.
Hans Albers hat hier wohl seine beste Filmrolle gefunden. Neben ihm brillieren vor allem Brigitte Horney als Zarin, Ferdinand Marian als Cagliostro, Leo Slezak als Sultan und Gustav Waldau als gealterter Casanova.
Der Film sollte nicht nur nostalgiebeflissenes Publikum der älteren und mittleren Generationen erfreuen, sondern auch jungen Menschen demonstrieren, mit welchem künstlerischem Potential und mit welcher Sorgfalt man einst Unterhaltung fürs Kino gemacht hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!