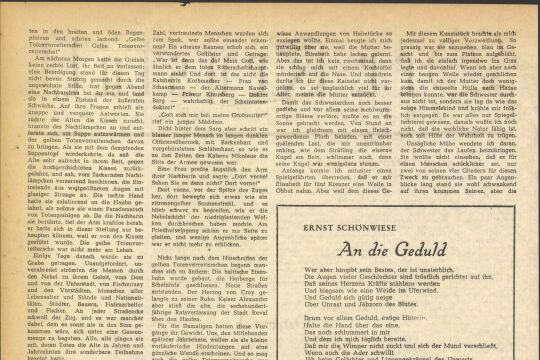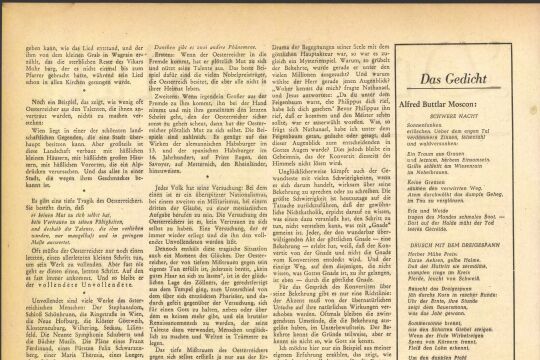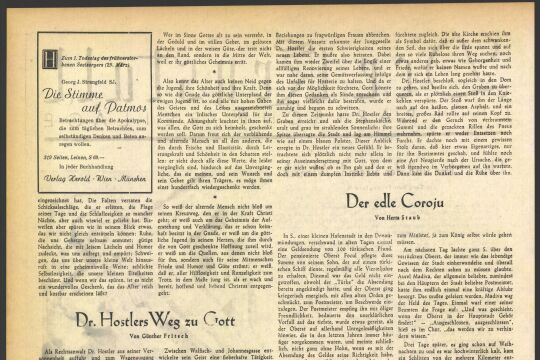Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Nachgeschmack schon vor dem Essen“
Vor allem in Wahlkampfzeiten pflegt der seit langem kraft amtlichen Dekrets für tot erklärte Antisemitismus in Österreich fallweise sehr öffentlich in Erscheinung zu treten. Der bevorstehende Wahlkampf wird nicht zuletzt in dieser Hinsicht ein Test für Österreichs politische und moralische Reife sein.
Das bedeutet eine Chance und eine Gefahr. Man ist in Versuchung zu sagen, daß Österreich nicht Österreich wäre, würde diese Chance genützt. Solcher Pessimismus wird durch die Lektüre der „Volkspresse“ vom 15. Juli bestärkt.
Schon seit 1966 belegte ein ÖVP- Abgeordneter und führender Mann des agrarischen Bereichs den damaligen Außenminister Kreisky in einer öffentlichen Versammlung mit einem seit 1945 angeblich aus dem Wortschatz gestrichenen, einem wahren Un-Wort, das inoffiziell freilich als wieder legalisiert durch Konvention und Gedankenlosigkeit gilt. Die „peinliche Entgleisung“ wurde nach der Wahl durch Entschuldigung „aus der Welt geschafft“.
Aber jene traurige Demaskierung unterlief einem von der emotionell aufgeladenen Atmosphäre einer Bauernversammlung getragenen Redner mitten im Wahlkampf.
Diesmal wird der schale Nachgeschmack schon vor dem Essen serviert, der erste massive antisemitische Akzent vor den Beginn des Wahlkampfes gesetzt. Er unterlief auch keinem prononcierten Nichtintellektuellen, wie damals, sondern einem Mann des in Ruhe formulierten, nochmals überlesenen, in die Setzerei geschickten und dann wieder gelesenen Wortes.
In der „Volkspresse“ des niederösterreichischen ÖAAB begrüßt also deren Chefredakteur sein Publikum mit einem herzlichen „Grüß Gott, liebe Leser!“ um diesen eine „Begebenheit aus meiner Jugend“ zu erzählen.
Einleitend betont der Arier Johann Moser seine Bodenständigkeit: „Meine Mutter hatte nach dem Tod des Vaters für uns drei Buben allein zu sorgen — das hieß schon etwas in den dreißiger Jahren. Natürlich gingen wir, wie es so unschön heißt, neben den Schuhen. Aber weil es gar nicht mehr anders ging, sollte für mich ein neues Hemd gekauft werden.“
Drei Geschäfte hat die Frau Moser, Sohn Moser zufolge, damals besucht. Erst das eines Herrn Meister: Große Kollektion, gute teure Hemden und billige schlechte. „Für ein gutes Hemd konnte, für ein billiges Hemd wollte sich meine Mutter nicht entscheiden.“
Sie geht also weiter: „Vor dem Geschäft des Herrn Feigenbaum stand dieser selbst. Er begrüßte uns in devotester Art und lud zum Eintreten ein. Da wurde herbeigeschleppt, ausgebreitet, angepriesen und — gehandelt. Kostete ein Hemd zuerst zehn, waren es wenige Minuten später nur noch acht, sieben, sechseinhalb usw. Schilling. Mir schien, als wollte uns Herr Feigenbaum ein Hemd schenken. Das Verhalten meiner Mutter war mir daher unverständlich: Sie packte mich bei der Hand und verließ den Laden.“
Herr Schmitz ist das Gegenteil vom Herrn Feigenbaum: „Keine Spur von
Unterwürfigkeit, dafür forsch, sicher im Auftreten und — im Ankündigen der Preise. Geschmolzene Preise, bei angeblich bester Qualität."
Frau Moser scheint nicht sehr versiert gewesen zu sein, da ihr entging, was ihr freilich zum Chefredakteur heranwachsender Sohn durchschaute:
Schmitz läßt sich vom Boten des Feigenbaum einen billigen Ramsch bringen, den er der Witwe als Qualitätsware andreht. Leider geht das Hemd beim ersten Waschen so ein, daß es der Knabe nicht mehr anzie- hen kann: „Und Reklamationen nützen auch nichts mehr, denn Herr Schmitz redet sich auf Herrn Feigenbaum, dieser aber wieder auf Herrn Schmitz aus … ,Hätte ich das Hemd doch beim Meister gekauft’, jammerte meine Mutter.“
Oder — was Moser eigentlich meint — die ÖVP gewählt. Was etwas ehrlicher ausgedrückt auch überzeugender geklungen hätte. Denn unlogische Geschichten haben oft ihre eigene, widerborstige Logik, und wenn aus diesem hanebüchenen Text etwas hervorgeht, dann doch wohl, daß Frau Moser auf jeden Fall auch bei Herrn Feigenbaum direkt besser gekauft hätte.
Aber es geht hier nicht um die Ungeschicklichkeit der Agitation, sondern um die Unanständigkeit der Methode, nämlich um einen Antisemitismus, der möglicherweise unterschwellig hätte wirken sollen und durch schreiberische Ungeschicklichkeit so plakativ geriet. Oder war Holzhammerarbeit beabsichtigt? Dafür würde die Wahl eines Kreisky-Bildes auf der ersten Seite derselben „Volkspresse“ sprechen, das aus der „National- und Soldatenzeitung“ stammen dürfte.
Es bedarf also wieder einmal jener Klarstellung, für die es immer, wenn sie notwendig wird, fünf Minuten nach zwölf ist: Antisemitismus in der politischen Publizistik kann sich dieses Land nicht leisten und hat die ÖVP nicht notwendig. Wer es trotzdem damit versucht, leistet seiner Partei einen miserablen Dienst.
Die Frau Moser dieser Geschichte hat wie so viele Mosers mit dem Kaufmann Feigenbaum offensichtlich keine schlechte Erfahrung machen können, weil sie es vorzog, sich vom forschen nordischen Schmitz betrügen zu lassen. Wenige Jahre später, Chefredakteur Moser müßte sich doch auch daran erinnern, hat wohl Schmitz das Geschäft des Feigenbaum arisiert und Feigenbaum kam, wie so viele Feigenbaums, in Auschwitz um, falls es ihm nicht gelang, zu entkommen.
Im Artikel des Chefredakteurs Moser, in dem der anständige Herr Meister die ÖVP und Schmitz die FPÖ symbolisiert, wird keine Partei genannt, also auch keine SPÖ, und kein Politiker, also auch kein Kreisky. Er braucht auch nicht genannt zu werden. Man versteht einander auch so in diesem Land, in dem man einander am Augenzwinkern, wenn der Name Kreisky fällt, erkennt, und in dem die öffentliche antisemitische „Entgleisung“ nicht einmal das Zehntel vom Zehntel von jenem unsichtbaren Eisberg antisemitischer Vorurteile, Redensarten und Emotionen ist, an die sich so leicht appellieren läßt.
Ertappte pflegen nachher zu sagen, man sehe Gespenster. Vielleicht ist der ganze Antisemitismus ein Gespenst. Aber die ältesten Gespenster haben noch immer die höchste Lebenserwartung. Und Wahlkämpfe scheinen noch immer ihre Mitternachtsstunde.
Dem Verfasser der Parabel von den drei Kaufleuten aber wäre zu empfehlen, seinen „lieben Lesern“ nächstens die Lessingsche Ringparabel zu erzählen, falls er sie kennt. Auch sie hat ihre parteipolitische Aktualität.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!