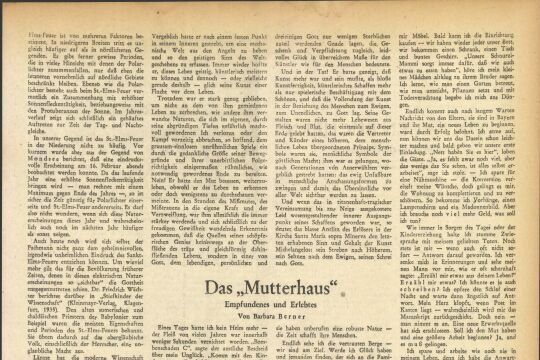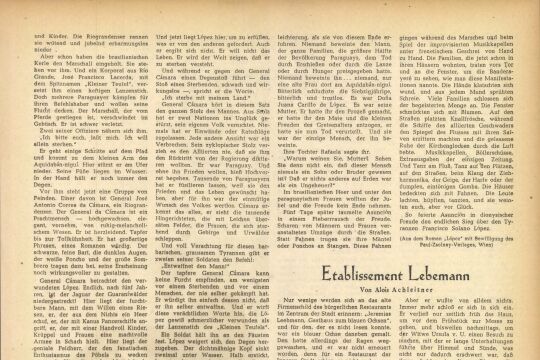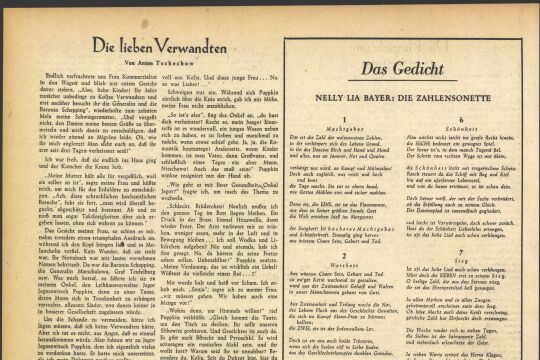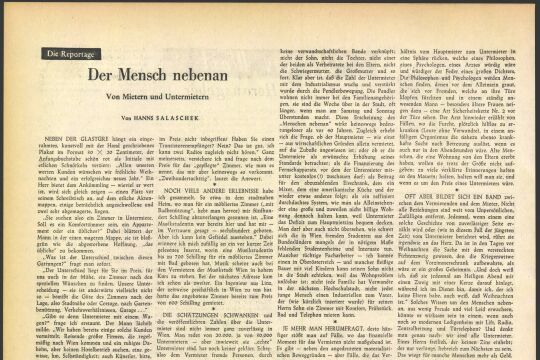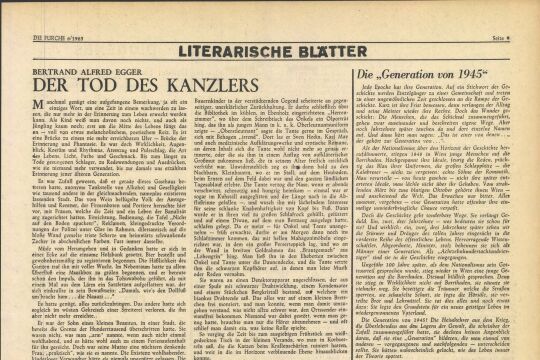Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Stille Stunden
Tante Martha spricht gern und fließend Französisch, aber das ist der einzige Luxus, zu dem sie sich bekennt. In ihrer Garderobe, die mehr einem Lebensstil als der Mode verpflichtet ist, hält sie sich an das Englische. Das Zeug ist zwar auch nicht gerade billig, aber dafür haltbar. Nichts zum Wegwerfen. Man trägt es auf. Tante Martha gehört zu den alten Damen, die angeblich aussterben, aber wohl immer schon selten gewesen sind und offenbar doch irgendwie nachwachsen, sehr gepflegt, von zartem Lavendelduft umwittert und im Grund von einer Bescheidenheit, die weniger damenhafte Damen sich niemals leisten können. Möglicherweise sind sie früher mehr aufgefallen. Ihr Biotop ist die Innere Stadt. Wie sie sich vermehren, ist ein un-gelüftetes Geheimnis.
Tante Marthas Eltern haben ihr nicht viel Geld hinterlassen, aber dafür eine etwas düstere, für eine alleinstehende alte Dame viel zu große Wohnung in bester Lage am Kohlmarkt, in unmittelbarer Nähe der Hofburg und der wichtigsten Ministerien. Das Vermögen, auf das eine solche Wohnung schließen läßt, dürfte sich in Kriegsanleihen oder in der Weltwirtschaftskrise verflüchtigt haben, vor mehr als einem halben Jahrhundert also. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte Tante Martha vom Verkauf der zunächst reichlich verfügbaren Möbel, Bilder und Teppiche. „Viel zu billig hergegeben“, grollte Tante Martha nachträglich, aber ohne diese doch sehr massiven Zuschüsse hätte sie die Wohnung nicht halten können, und ihr Gehalt als Sekretärin im Unterrichtsministerium reichte damals bestenfalls für ein Zubrot.
Gewissermaßen aus Bescheidenheit hat Tante Martha keinen Beruf erlernt. Sie war eine höhere Tochter auf Abruf gewesen, und als der Abruf dann nicht erfolgte, war sie schließlich als Sekretärin in dieses Ministerium eingetreten, gerade noch rechtzeitig für ihre Pragmatisierung und die spätere Pension. Eine perfekte Sekretärin war bestimmt nie aus ihr geworden, mit mehr als zwei Fingern auf der Maschine schreiben konnte sie bis zuletzt nicht, und ihre Behauptung, daß sie alles am liebsten im Kopf gehabt habe, legt die Vermutung nahe, daß es um die Ordnung in ihren Akten nicht sehr gut bestellt war.
Ihre Kolleginnen fanden sie hochnäsig, weil sie kein Hehl daraus machte, daß sie diesen Beruf nicht als Rechtfertigung ihres Daseins betrachtete, aber bei ihren Vorgesetzten war sie zumindest wohlgelitten. Sie deuteten an, daß es sich gewissermaßen um einen Sozialfall handle, man dürfe doch die arme Frau nicht dafür verantwortlich machen, daß ihr die Ausbildung in so trivialen Belangen vorenthalten worden war. Unausgesprochen teilten sie wohl auch ihre Meinung, daß eine Dame, die aus einer Wohnung am Kohlmarkt kam, großzügiger beurteilt werden muß als irgendein Mädchen, das sich aus kleinen Verhältnissen zur Sekretärin hochgearbeitet hat. So ein Mädchen hat immerhin ein Ziel erreicht.
Tante Martha war zu stolz, um auch nur schlechte Laune zu zeigen, aber die Munterkeit, wie sie mit Telefonen und Staatsbürgern umsprang, hatte manchmal etwas Tragisches. Feinfühlenden Menschen entgeht das nicht. Vor allem jedoch hatte Tante Martha das Ohr des Sektionschefs.
Beide — sowohl Tante Martha als auch der Sektionschef - waren im kanonischen Alter, beide fest im konservativen Lager verankert, der Sektionschef ein anerkannt treuer Familienvater, Tante Martha möglicherweise noch immer Jungfrau. In der Hierarchie des Ministeriums trennte die beiden ein Abgrund. Bei aller Höflichkeit, die der Sektionschef aus Prinzip dem schwächeren Geschlecht bezeugte, hielt er doch unmißverständlich unter solchen Umständen durchwegs Distanz, nur im Verhältnis zu Tante Martha schwang in der Art, wie er sie grüßte oder ihr einen Auftrag erteilte, etwas undefinierbar Intimes, ja Komplizenhaftes mit, ein Augenzwinkern war dabei, ein Zucken um die Mundwinkel, das kurze, zusätzliche Nicken, in dem sich ein geheimes Einverständnis ausdrückt.
Man war beunruhigt. Man rätselte. Für den Sektionschef wäre es ein Leichtes gewesen, beispielsweise Tante Martha in sein Vorzimmer zu versetzen, aber das schien weder ihm noch ihr einzufallen. Die einzige Erklärung, die einigermaßen befriedigte, weim-gleich darum nicht auch schon kritiklos hingenommen wurde, unterstellte ihnen ein verbindendes Standesbewußtsein, ein mehr oder weniger zufälliges Zusammentreffen auf derselben Sprosse der sozialen Leiter, der Sektionschef im Aufstieg und Tante Martha im Abstieg, außerhalb des Amtes natürlich, auf einer privaten Ebene, die jedoch genau so schief war wie die meisten Ebenen, auch eine der Facetten des gesellschaftlichen Uberbaus, den man sich am einleuchtendsten als eine Kuppel über der Bevölkerungspyramide vorstellen kann. Ohne Kuppler und Kuppelei ist dieser Uberbau nicht denkbar.
Andererseits wußte man über den außerdienstlichen Umgang des Sektionschefs ziemlich genau Bescheid, nicht nur aus seinem offiziellen Terminkalender, sondern auch auf dem Umweg über Kinder, die mit den Kindern oder Enkelkindern des Sektionschefs in die Schule gingen oder studierten. Man wußte ziemlich genau, mit wem der Sektionschef verkehrte, und dazu gehörte jedenfalls nicht Tante Martha.
Ich nehme an, daß Tante Martha in ihrer noblen Unschuld die Anspielungen gar nicht verstand, die man sich keineswegs verkniff, aber trotzdem errötete sie heftig, als ich ihr zwischen zwei Tassen Tee und einigen Sardellenbrötchen auf den Kopf zusagte, was ich mir ausgerechnet hatte.
„Wenn du meinst, daß der Lärm jemanden stört“, sagte ich, „dann schreibe ich eben mit der Hand. Ich muß nicht mit der Maschine schreiben. Aber ich brauche ein ruhiges Zimmer, in dem ich arbei-
ten kann. Nur von eins bis fünf, wenn du nicht zu Hause bist. Du wirst mich gar nicht sehen. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, wenn du es mir nicht selbst angeboten hättest.“
„Habe ich das?“ fragte sie. „Aber das ist schon lange her!“
„Damals hast du noch keinen Untermieter gehabt“, sagte ich.
Mein Mitgefühl enthielt auch eine Spur Trauer und einen Hauch Verachtung. Ich hatte an Tante Martha geglaubt und war enttäuscht worden. Der Zug der Zeit war auch über sie hinweggerollt. Erst hatte sie die besten Stunden ihres Tages an dieses Ministerium verkauft, und jetzt gab es auch noch einen Untermieter. Das Bollwerk Tante Martha war gefallen. Alles nur mehr Fassade, der schöne Schein so dünn wie die Butter auf den Sardellenbrötchen. Ich kannte das von anderen
Tanten: „Paying guests“ hieß das bei ihnen.
„Untermieter?“ wiederholte Tante Martha. Ein sieghaftes Lächeln verklärte ihr Gesicht. „Nein. Einen Untermieter habe ich nicht.“
„Einen ,Paying guest’“, schob ich nach.
Entrüstet wies Tante Martha auch diesen Verdacht von sich. Nun erst wurde ich so richtig neugierig. Tante Martha war nervös, die Spur war heiß.
„Soll ich dir die Karten legen?“ fragte ich, wohl wissend, daß sie diesem Angebot nicht widerstehen konnte. Ich kannte ihre kleinen Schwächen. Ich bezweifle, daß sie auch nur eine Zeile von mir gelesen hat, aber sie hielt mich für ein Genie.
Die erste Karte war der Treffkönig. Tante Marthas Bäckchen glühten.
J^ein junger Mann“, stellte ich fest. „Ein reiferer Herr, nicht wahr?“
Natürlich. Tante Martha bebte. Ich schlug eine Karofünf auf.
„Er geht hier ein und aus“, behauptete ich. „Aber was tut er? Tante Martha!“ Die nächste Karte war das Herzas: „Er liebt dich!“
„Unsinn!“ protestierte Tante Martha.
Sehr nachdenklich betrachtete ich hierauf den Karokönig. „Oh, mehrere Herren“, schloß ich. Tante Martha unterdrückte ein Nicken. „Vielleicht träumen sie von dir? Das Vertrackte an den Karten ist nämlich, daß du nicht mit Sicherheit unterscheiden kannst, was wirklich ist - und was die Leute träumen…“ Das war ein Blattschuß.
„Ich will es nicht wissen!“ brach es aus Tante Martha hervor. „Ich will nicht wissen, was sie träumen. Warum sollen sie nicht träumen? Meinetwegen! Ich weiß nur, daß es Menschen gibt, die ohne ih^ ren Mittagsschlaf nicht leben können. Das weiß ich von meinem Vater. Vor allem Männer. Was weiß ich, wovon sie träumen?“
„Vielleicht von dir?“ schlug ich vor. „Wie viele sind es denn wirk-Uch?“
„Geh! Geh jetzt!“ rief sie. „Ich will dich nie mehr sehen!“
Das war freilich übertrieben. An manchen Tagen ist jedes Zimmer von einem Mittagsschläfer belegt, aber das macht mir nichts aus. Ich sitze ohnedies am liebsten in der Küche, lausche auf das Schnarchen hinter den Wänden, vergleiche es mit dem Schnurren von großen Katzen oder fühle mich umbraust von der Brandung eines Meeres.
Es ist wunderbar und sehr in-spirativ, im Mittelpunkt so vieler Träume zu sitzen. Ich halte Kaffee bereit für Bedarfsfälle, die gewöhnlich gegen drei eintreten. Gegen halb vier öffne ich die Fenster. Gegen fünf kommt Tante Martha, gespannt auf die kleinen Aufmerksamkeiten, die sie hin und wieder erwarten. Aber dann bin auch ich regelmäßig schon aus dem Haus.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!