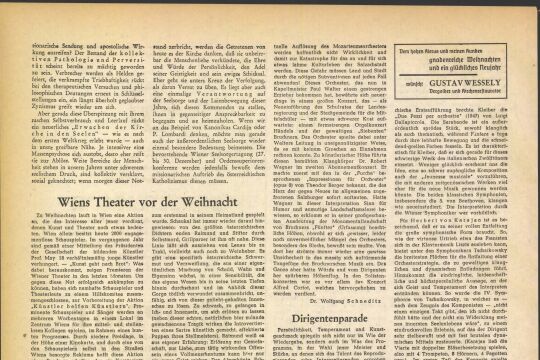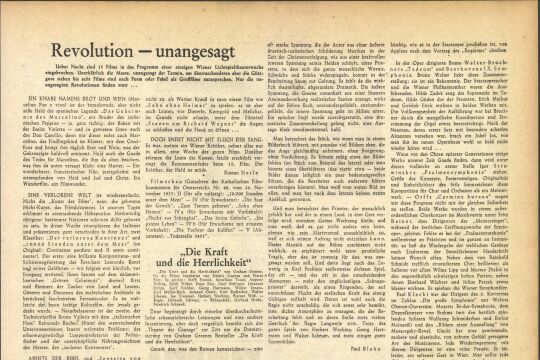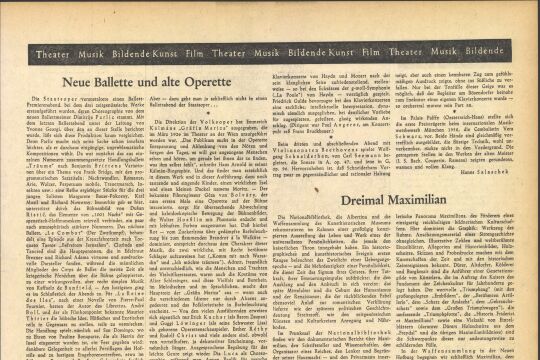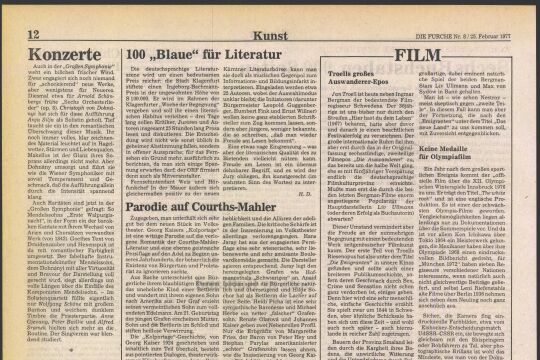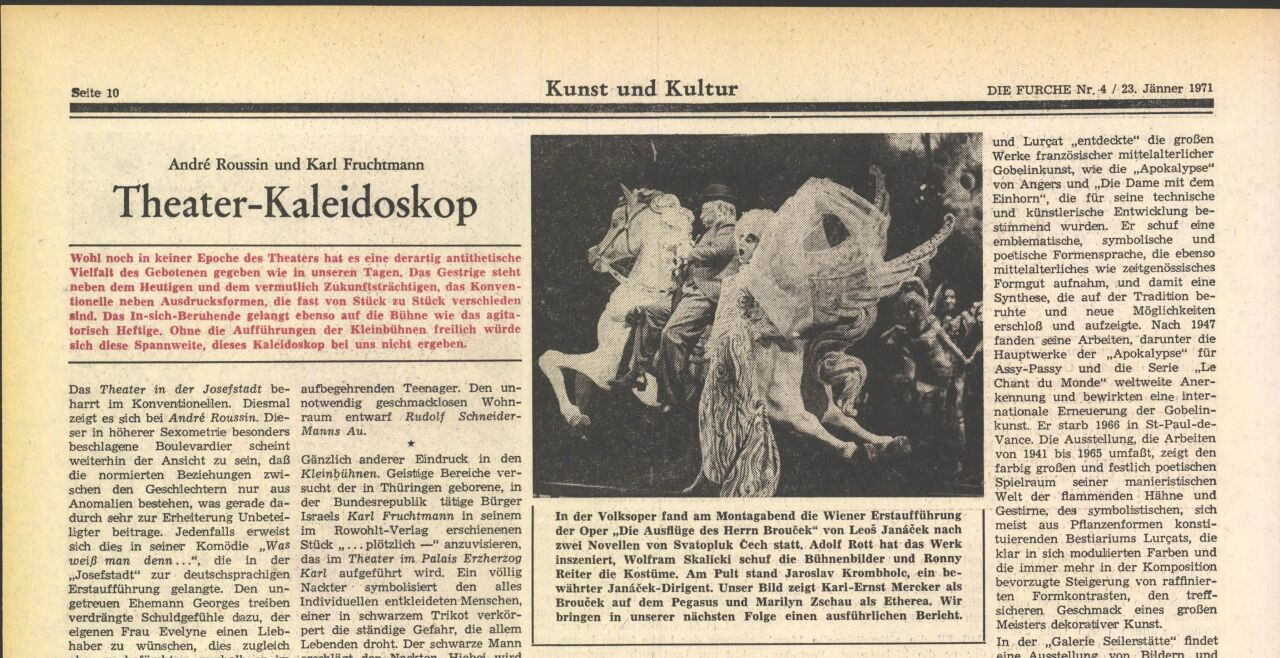
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Weill, Bruckner, Verdi
Unverständlich, daß man Kurt Weills originelles Instrumentalschaffen in den Konzertprogrammen so vernachlässigt. Nicht einmal anläßlich seines 70. Geburtstages im vergangenen Jahr nahm man sich die Mühe, die wichtigsten Werke aufzuführen. Gerade Stücke wie sein Konzert für Violine und Blasorchester (op. 12) von 1924 wirken heute aktueller denn je. Entspricht es doch mehr den Vorstellungen von den Beziehungen zwischen Künsten und Politik als manche Avantgardemusik, die mit aufwendigen politischen und soziologischen Theorien untermauert werden muß. Vor allem, weil Weill darin versuchte, den „ästhetischen Radikalismus“ der Berliner November gruppe musikalisch zu erfassen. Es ist sozusagen mit ein geistesgeschichtliches Dokument eines „radikalen Expressionismus humanitärer und demokratischer Ausprägung“.
Ernst Kovacic, der vielversprechende junge Geiger, spielte im Musikverein den Solopart mit rundem, glattem Ton, dem es nicht an Plastizität mangelte. Mit viel Sentiment strich er ins weiche „Quasi-F-Dür“. Horší Stein leitete die Wiener Philharmonischen Bläser akkurat. Ein delikates Spiel mit schön austarierten Klangblöcken und reizvollen Linienverflechtungen. Mozarts Serenade, K. V. 361, atmete ein wenig bayrische Gemütlichkeit.
Rafael Kubelik am Pult der Philharmoniker ist ein Garant für ein ungewöhnliches Konzert, in dem es keinen Moment an Kontrasten und Spannungen mangelt. Bruckners „Vierte“ gestaltet er entschlackt: in großen Bögen, wobei einer sich aus dem anderen entwickelt. Besonders intensiv wirken seine Andante- und Adagio-Passagen, die er mit weichem Stredchergesang anfüllt, monumental die Höhepunkte, in denen er das Blech voll aus der Reserve holt. Mozarts „Prager Symphonie“ (K. V. 504) wurde sehr leicht und schlank musiziert. Schade, daß sämtliche Wiederholungen unberücksichtigt blieben.
Zdenek Macai, eine Entdeckung des Wiener Konzerthauses für Wien, dirigierte dort Verdis „Requiem“. Er war damit noch ein wenig überfordert. Zuviel an dem ohnedies zur Theatralik neigenden Werk blieb an der Oberfläche. Macai verschrieb sich dem Effekt. Und so klang denn auch die ganze Wiedergabe: Brillant, aber kalt. Staatsopernchor und Symphoniker waren zwar mit viel Engagement beteiligt, das Solistenquartett wirkte eher unausgeglichen, vor allem in den einzelnen Partien nicht gleichwertig.
Einen eher durchschnittlichen, spannungsarmen Abend bescherte Otmar Suitner mit den Wiener Symphonikern im Musikverein: Seine Wiedergabe der „Romantischen Symphonie“ von Bruckner blieb in den Steigerungen auf der Strecke, wirkte kontrastarm und in den großen Linien zu brüchig. Fast schien es, als hätte er zu wenig Ruhe und Kraft, diese Sätze breit auszuspinnen bzw. das Scherzo in verhaltener Lustigkeit dahintollen zu lassen. In der Aufführung von Richard Strauss’ „Don Quixote“ bestätigte sich erneut der Cellist Michail Chomitzer als Virtuose von Rang. Großartig, wie er den närrischen Idealisten charakterisiert, wie er Kauzigkeit und Sehnsucht nach der Dulcinea der Hinterhöfe mit versteckter Ironie ausspielt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!