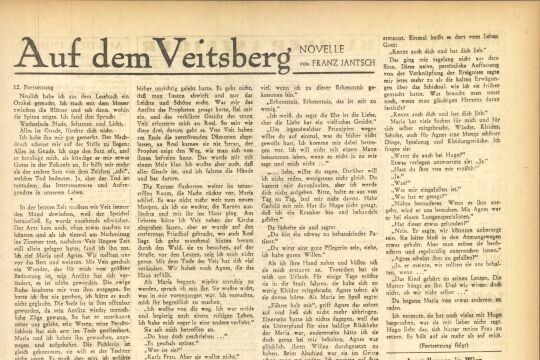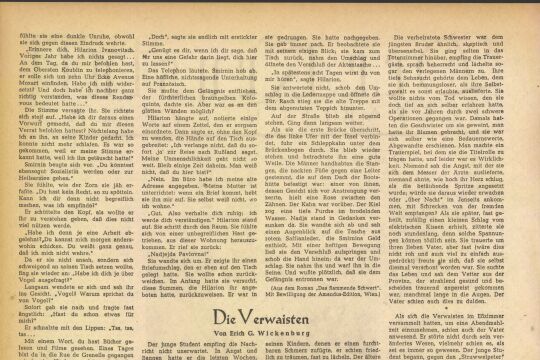Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Zum letzten Mal ein rosa Kleid“
Der Morgen des 1. April 1922 auf der portugiesisch-afrikanischen Insel Madeira war sonnig und klar. Wir Kinder waren schon früh hinausgeschickt worden in den blumenprächtigen tropischen Garten der Quinta do Monte. Tief unten, jenseits der Stadt Funchal, glitzerte der Atlantische Ozean, während hinter uns die dunklen, vulkanischen Höhen der Toreiro de Luta in den tiefblauen Himmel ragten. Ich erinnere mich an die schönen, bunten, roten und weißen Kamelienblüten, die von den Bäumen herabgefallen waren und die von uns, in Ermangelung des heimatlichen Winters, als Wurfgeschoße einer Schneeballschlacht verwendet wurden. Die Freude am Spiel war allerdings nicht uneingeschränkt. Seit Tagen lag unser Vater im Vorderzimmer des ebenerdigen Hauses schwer erkrankt darnieder. — Wie ernst es um ihn stand, hatte man uns allerdings nicht gesagt. Als
Ältester von uns sieben wußte ich etwas mehr: vor wenigen Abenden hatte man mich aus dem Bett geholt, damit ich dabei sei, wenn der Priester ihm die letzte Ölung spendete.
Knapp vor 9 Uhr an diesem 1. April betrat unsere Mutter den Garten. Sie trug ein leichtes, rosa Kleid — es war das letzte Mal, daß ich sie in Farben sah. Sie führte mich fort, zuerst, ohne den Grund anzugeben. Als wir uns dann dem Hause näherten und die Geschwister außer Hörweite waren, sagte sie, daß mich mein Vater rufen lasse, um Zeuge zu sein, wie ein Christ zu seinem Schöpfer heimkehrte.
Durch drei Stunden, von 9 bis 12 Uhr, wohnte ich seinem Sterben bei. Meist kniete ich links vom Bett, an dessen Ende das Aller-heiligste stand. Es war kein leichter Todeskampf. Mein Vater war jung und kräftig, und seine Natur widerstand zäh der zerstörenden Krankheit, dem langsamen Erstickungstod. Und trotzdem war dieses Ende kein erschreckender Anblick: wenn auch der Körper noch so litt, der Geist war ruhig. Wenige Stunden früher hatte er, sozusagen in Zusammenfassung seines Lebens, die Worte gesprochen: „Mein Bestreben war es immer, den Willen Gottes zu erkennen und ihn zu befolgen, und zwar auf das vollkommenste.“ Seine Aufgabe war damit erfüllt. Trotz der physischen Schmerzen für ihn und der seelischen Erschütterung für uns, war sein irdisches Ende ein friedliches Hinübergehen in eine bessere Welt.
Als mein Vater starb, war ich neun Jahre alt. Schon seit früher Kindheit war ich zutiefst mit ihm verbunden, und gerade in den letzten Wochen auf Madeira hatte er viel zu mir gesprochen. So hatte ich zumindest einen kindlichen Überblick über ein Leben erhalten, das wie wenige andere erfüllt war von Rückschlägen und Enttäuschungen, das in menschlicher Hinsicht als gescheitert betrachtet werden kann. Er hat den Frieden gewollt und mußte Krieg führen. Er hatte die Einheit gesucht und mußte an verantwortlicher Stelle die Zerstörung des Vielvölkerreiches mitansehen. Zahlreiche Freunde hatten ihm den Rücken gekehrt, ja ihn sogar verraten.
Und doch haben mir gerade die drei Stunden in dem Sterbezimmer der Quinta do Monte gezeigt, daß meines Vaters Leben nicht unglücklich war. Als ich ihn an seinem letzten Tag — in der Stunde der Wahrheit, wie es die Spanier nennen — sah, wußte ich, daß sein Leben erfolgreich gewesen ist. Angesichts des Todes gibt es keine Selbsttäuschung. Man bleibt allein, und diesseitige Errungenschaft zählt nicht mehr. Wenn man seinem Schöpfer entgegentritt, gilt vor diesem nur Pflichterfüllung und guter Wille. Gott verlangt von den Menschen nicht, ihm Siegesberichte zu bringen. Den Erfolg gibt er. Von uns erwartet er nur, daß wir unser Bestes tun.
Diese Lehre ist mir, wie es mein Vater wollte, die wertvollste Erfahrung für das spätere Leben geblieben. Sein Sterben hat mir gezeigt, daß es, solange das eigene Gewissen ruhig ist, keinen wirklichen Fehlschlag geben kann. Und das ist schließlich das einzige, wirkliche Geheimnis des Glückes — auch auf unserer Erde.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!