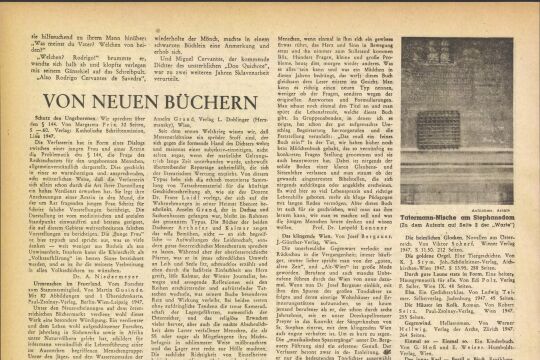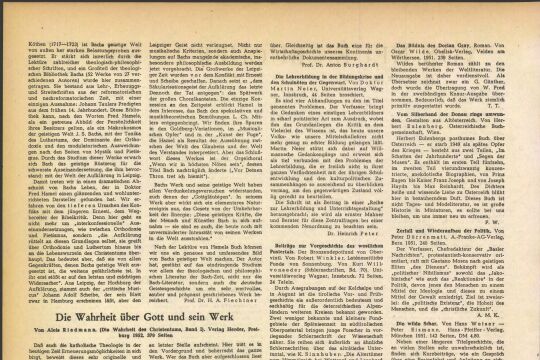Ein Schweizer, ein Amerikaner und ein Österreicher auf Spurensuche nach dem österreichischen Wesen. Skurriles und Ermutigendes, doch so anders als die anderen ist der Österreicher heute auch nicht mehr.
Der Schweizer Österreich-Beobachter mit Wiener Wurzeln mütterlicherseits glaubt, dass er das Verhältnis des durchschnittlichen Österreichers zu all den Dingen, die diesem unangenehm sind, in einem Wort, „eigentlich mehr eine Lautäußerung“ zusammenfassen kann: „No jaa!“ Als Beispiel, wo dieses Resümee „möglichst langezogen, in etwas tieferer Stimmlage und beschwichtigendem Tonfall vorgebracht“ wird, nennt der Österreich-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung, Charles E. Ritterband, die NS-Zeit. Und erklärt in seinen publizistischen Expeditionen „Dem Österreichischen auf der Spur“: „Mit jenem gemütvollen ‚No jaa!‘ ist alles gesagt und alles relativiert, ist die Sache abgeschlossen, bedarf keiner weiteren Erläuterung – und man kann, mit der Welt und vor allem mit sich selbst zufrieden, zum gemütlichen Teil übergehen, zum Vierterl Weiß, beim Heurigen.“
„No jaa!“ möchte man aber auch zu dieser Analyse der österreichischen Seele sagen. Das war einmal so, bestimmt, aber so ist das nicht mehr – nicht beim Thema Nationalsozialismus und nicht beim Wein. Die Erkenntnis, zwischen 1938 und 1945 auch Opfer, aber mehr Täter gewesen zu sein, ist angekommen. Das Vierterl Weiß beim Heurigen und anderswo ist hingegen abgekommen. Vierterl ja, aber wenn, dann g’spritzt, ansonsten greifen die Österreicher mittlerweile doch vorwiegend zum Achterl. Und zur 0,75 Liter Bouteille und nicht mehr zum Doppler – allein Hermann Nitsch lässt seinen Wein noch zweilitrig abfüllen, aber der ist ein Künstler.
Im Gehsteig-Hektik-Spitzenfeld
Ansonsten sind Herr und Frau Österreicher mittlerweile doch sehr „normal“ geworden. Ritterband diagnostiziert das mit einiger Verwunderung sogar selber: Im weltweiten Hektik-Vergleich, der auf der Durchschnittszeit von Fußgängern für 18 Meter Gehsteig beruht, liegt das angeblich so gemütliche Wien mit 12,06 Sekunden im Spitzenfeld. Nur eine gute Sekunde hinter der hektischsten Stadt Singapur (10,55) und nur um einen Lidschlag von New York (12,0) geschlagen. Und so wie sich die große Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher bei Geschichtsaufarbeitung, Wein und Stress internationalen Maßstäben angepasst hat, so ist das Land als Ganzes normaler geworden.
So sieht das auch Anton Pelinka in seiner politischen Autobiografie „Nach der Windstille“: „Österreich hat sich zu einer weitgehend durchschnittlichen europäischen Normaldemokratie gewandelt. Österreich ist weder erkennbar ‚besser‘ noch erkennbar ‚schlechter‘ als andere Staaten vergleichbarer Entwicklungsniveaus. Österreich ist nicht anders – und das beruhigt.“
Aber Österreich war anders – bis 1986. Im Jahr davor hatte Pelinka sein Buch „Windstille. Klagen über Österreich“ herausgebracht. Der Politikwissenschafter beklagte darin, die Abwesenheit von Konflikten, die dem Land zwar den päpstlich approbierten Ruf einer „Insel der Seligen“ eingebracht, die für eine lebendige Demokratie aber unverzichtbaren Interessensgegensätze ausgespart hat. Der „österreichische Weg“ und das „österreichische Klima“ beruhten für Pelinka jedoch auf einer Scheinordnung und er prognostizierte 1985: „Die Windstille neigt sich dem Ende zu. … Alles spricht dafür, dass Österreich aus der Phase der Windstille allmählich in eine Phase der Bewegung eintritt.“
Waldheim, Groer, Haider und Pferd
Eine profil-Karikatur hat die Pelinka-Prophezeiung Ende 1986 auf den Bleistiftstrich gebracht: Ein Pferd, auf dem Waldheim, Groer und Haider ritten. Die Zeichnung symbolisierte die Ankunft von drei „apokalyptischen Reitern“ und den Ausbruch der österreichischen Wende; Pelinka: „Mit Waldheim ritt eine bis dahin verdrängte Vergangenheit ein; mit Groer hieß es zurück in eine teilweise andere Vergangenheit; und mit Haider wurde die Unverschämtheit des Umgangs mit der Vergangenheit symbolisiert.“
Und seitdem dieser politische und kirchliche, da wie dort vielgestaltig revisionistische Tsunami über Österreich hinweggefegt ist, gibt es hierzulande keine Insel mehr – weder für Seliges, noch für Unseliges. Pelinka hat deswegen seine Autobiografie nach 25 Jahren weitergeschrieben und dem Wind dieser Zeit nachgespürt, ohne die vorhergehenden windstillen Kapitel wegzulassen.
So ist eine politisch-autobiografische Melange entstanden, die mehr nach Österreich schmeckt als die schweizerischen „Schlagzeilen mit Schlagobers“, serviert von Charles E. Ritterband. Denn dessen sortierte Arbeitsproben aus acht Jahren Korrespondententätigkeit in Wien sind in dieser Aneinanderreihung – um in der Küchensprache zu bleiben – einfach zu geil, zu üppig. Zu oft taucht beim Lesen vor dem geistigen Auge der über dieses Land und seine Leute nur mehr seinen Kopf schüttelnde Korrespondent auf. Gut beobachtet und beschrieben, bleibt die Spurensuche nach dem Österreichischen ohne die zusammenhängende Analyse im Dickicht aus Skurrilitäten stecken.
Dafür schlägt entweder der österreichische Teil von Ritterbands Wurzeln durch oder der Autor hat hier viel gelernt: Denn einerseits mokiert er sich über die (nicht mehr vorhandenen) „beiden Reichshälften“ in Österreich, andererseits lässt er zum Geleit in sein Buch Franz Vranitzky, Andreas Khol, Heide Schmidt und Alexander van (sic!) der Bellen Elogen auf die NZZ und seine Person schreiben – Respekt! Besser hätte das auch der gelernteste Österreicher nicht austarieren können.
Aber wahrscheinlich ist es nur der österreichische Neid auf die Schweizer Selbstgewissheit, dass einen die von dort kommende Kritik so schnell verstört. Aber mit dem Rütlischwur im geschichtlichen Rücken hat man dort leicht lachen. 718 Jahre Identität ist nicht nichts. Was kann da schon „das Österreichische“ an historischer Verwurzelung aufbieten?
Nicht viel, zeigt William M. Johnston im Buch „Der Österreichische Mensch“. Der amerikanische Kulturhistoriker hat (auf Deutsch!) eine „Kulturgeschichte der Eigenart Österreichs geschrieben“. Im Verlagsprospekt heißt es: „Wer die Frage stellt ‚Was heißt Österreich?‘ wird in diesem Buch unerhörte Antworten bekommen.“
Umgekrempelter Identitätshaushalt
Stimmt: Johnston krempelt den österreichischen Identitätshaushalt völlig um. Denn der Staat, den nach dem Zusammenbruch der Monarchie keiner wollte, war auch ein „Staat, dessen Kultur keiner verstand“. Von den Habsburgern als Familiensache definiert, war Österreich, laut Johnston, nie eine Volkssache. Nicht für das Volk, nicht für die Wissenschaft.
Vor 1914 befasste sich niemand mit den Kernfrage: Was ist ein Österreicher? Worin unterscheidet er sich vom Reichsdeutschen, Tschechen, Franzosen, Italiener…? Aber auch nach 1918 ging die Ignoranz am Österreichischen großteils weiter. Gut zwei Dutzend Schriftstellern und Essayisten hat Johnston aber doch gefunden, die den Österreichern die Eigenart Österreichs zu erklären versuchten – oft verkehrt, meist umsonst.
Doch „wir können von ihrem Einfallsreichtum lernen“, schlägt Johnston vor, „und von ihrem Engagement für Österreich, aber nicht unbedingt von ihrer Obsession mit Deutschland und auch nicht von ihrer Trauer um Kakanien. Ihre Essays führen uns vor Augen, wie sehr sich die Zweite Republik vom Habsburgerreich und der Ersten Republik entfernt hat.“
Gut so, du endlich glücklich normales Österreich. Oder „passt scho!“, wie wir auch gerne sagen.
Nach der Windstille.
Eine politische Autobiografie
Von Anton Pelinka,
Lesethek 2009, 168 S., geb., e 21,90
Dem Österreichischen auf der Spur.
Expeditionen eines NZZ-Korrespondenten Von Charles E. Ritterband,
Böhlau 2009, 200 S., geb., e 25,60
Der österreichische Mensch. Kulturgeschichte der Eigenart Österreichs
Von William M. Johnston;
Böhlau 2009, 336 S., geb., e 36,–
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!