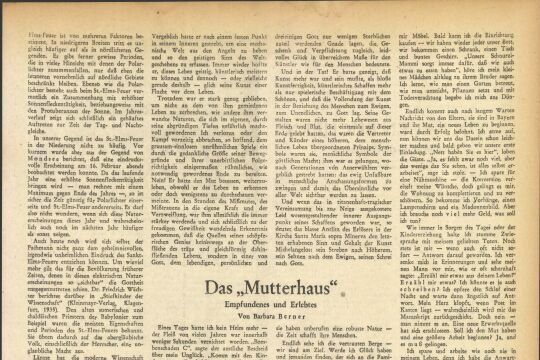Der israelische Sperrwall wächst auch um die palästinensische Stadt Bethlehem. Viele gehen weg - oder wollen weg. Für die Christen - längst eine Minderheit - ist diese Abwanderung besonders gravierend. Eine Reportage von Dolores Bauer.
Nein, ich gehe hier nicht mehr weg, was immer noch kommen mag", sagt der Maschinenbau-Ingenieur Ghasoub Nasr mit fester Stimme und meint seine Heimatstadt Bethlehem. Er hat in Deutschland studiert und dann eine Weile in Amman gearbeitet, aber immer nur um zurückzukehren und zu bleiben. "Mein Volk lebte schon in diesem Land, als Josua mit viel versprechenden, prächtigen Früchten aus dem Traubental zu Mose und dem Volk der Hebräer zurückkehrte. Meine Sippe war schon christlich, als der Prophet Muhammad noch gar nicht geboren worden war."
Die Situation von Gashoub Nasr ist nicht einfach: Trotz seiner langen Erfahrung ist er heute arbeitslos und weiß oft nicht, wie er seine Familie ernähren soll, notabene seine fünf Kinder, von denen drei im Ausland und zwei an der Bethlehem University studieren, aber da hilft die ganze Großfamilie zusammen. Bildung ist für die Palästinenser, vor allem für die Christen in den vergangenen Jahrzehnten immer wichtiger geworden. Waren auch die Eltern noch ungebildet, vielleicht sogar Analphabeten, für die Bildung der Kinder wurde jedes Opfer gebracht.
Dableiben? Weggehen?
Die Soziologin Carole Dabdoub, sie hat in England studiert, bestätigt dies: "Ich komme aus einer durchschnittlichen christlichen Familie. Mein Vater hat ohne solide Bildung aber in harter Arbeit eine kleine Fabrik aufgebaut. Meine Mutter war zu Hause und kümmerte sich um unsere Erziehung: Manchmal habe ich sie gehasst, weil sie mir jeden Flirt, jede Party versaute. Aber heute sind meine Eltern meine Helden, weil sie mich gelehrt haben das Wichtige nicht nur zu tun, sondern auch zu vollenden."
"Das Kapital Palästinas waren immer die Menschen, aber das geht", meint Carole, "heute langsam verloren, weil einerseits die Lage immer enger und damit die Stimmung depressiver wird und das Geld wohl aus Mangel an Bedeutung gewinnt." Das habe schon während der ersten Intifada begonnen, meint die junge Frau und Mutter eines zweijährigen Sohnes: "Damals waren die Schulen immer wieder wochenlang geschlossen - und das hat irgendwie ein Loch in der Gesellschaft hinterlassen, durch das der Kapitalismus eingesickert ist."
Carole ist eine der vielen Christen in Bethlehem oder überhaupt in Palästina, die das Leben "draußen" kennen gelernt haben und vielleicht gerade deshalb wissen, wo ihre Wurzeln sind. Trotzdem belastet sie, während die israelische Trennmauer um die alte Stadt wächst, der Blick in die Zukunft: "Gerade als junger Mensch stelle ich mir die Frage, was ich für meinen kleinen Sohn aufbauen kann. Ich fühle mich herausgefordert, wenn ich an die 20 Jahren denke, wenn dieses kleine Kind ein junger Erwachsener sein wird: Was kann ich ihm geben, wenn ich dann 50 sein werde, wie werde ich ihm erklären können, warum ich geblieben, warum ich nicht weggegangen bin, solange es noch Zeit war? Solche Gedanken irritieren mich sehr."
Ein junger Mann, der an der Universität Touristik studiert hat und jetzt arbeitslos ist, aber im Kulturzentrum einen neuen Weg in der künstlerischen Glasschmelztechnik gefunden hat, kommt zu einem anderen Schluss: "Diese Arbeit in den Kunstwerkstätten war der wichtigste Schritt in meinem Leben. Ich hatte ja nie gewusst, welche kreative Kraft in mir steckt. Er musste erst gehoben werden und das schulde ich den Menschen hier, die mir diese Möglichkeit eröffnet haben. Aber", fährt er fort, "wenn ich zuschaue, wie die Mauer wächst, wenn ich den von Bulldozern eingeebneten Schneisen und den Elektrozäunen, die der Mauer so zu sagen die Spur legen, nachschaue, dann wird es in mir eng. Wenn diese Mauer fertig ist, möchte ich nicht mehr hier sein. Ich werde weggehen, auch wenn mein Herz blutet."
Die einen sind sicher verwurzelt, die anderen stellen sich der fragenden Reflexion, die dritten schmieden schmerzhafte Pläne.
Am folgenden Tag sitze ich auf der Terrasse eines kleinen Hauses direkt an dieser scheußlichen grauen Mauer aus Betonplatten. Acht Meter oder mehr ragt sie direkt vor mir auf. Ich weiß, dass ich wieder weggehen werde, aber die Bewohner des gemütlichen Hauses werden bleiben und wissen nicht einmal, ob ihr Haus stehen bleiben kann oder abgerissen werden wird. Mir gegenüber sitzt Gezan. Er ist Biologe an der Universität von Bethlehem: "Eines Morgens wurden wir vom Lärm der Bulldozer geweckt und drei Tage später stand da der erste Block - und der wuchs Platte um Platte weiter. Die wunderschöne Landschaft im Norden unseres Hauses ist betongrau geworden. Jeden Morgen die Frage: Was kommt noch? Welche Überraschungen haben sie noch für uns? Niemand da, zu dem wir gehen könnten. Keine Informationen. Wir fühlen uns allein gelassen. Verraten."
Meine Frage: "Also Weggehen?" - "Das ist keine Alternative. Ich kann nicht nur an mich, ich muss an mein Volk, an Palästina und seine Zukunft denken. Wir sind die Reserve für eine bessere Zukunft des Heiligen Landes, in dem Jesus geboren wurde, gelebt, gelehrt hat, gestorben und auferstanden ist. Er möge uns die Kraft geben, hier auszuharren, jeden Tag."
Menschenwürde heiligen
Ein Satz von Mitri Raheb, dem lutherischen Pfarrer der Weihnachtskirche in Bethlehem klingt mir nach: "Das Heilige Land ist nicht mehr heilig. Von diesem Konzept müssen wir unter den herrschenden Konzessionen endlich weg. Das bringt nichts mehr. Wir müssen uns um ein Konzept bemühen, das den Menschen in seiner Würde, in seinen Rechten und in seinen Pflichten heiligt, aber davon sind wird noch weit entfernt."
Daran zu arbeiten wäre aber auch eine Aufgabe - zum Beispiel der Christen in Europa. Es ginge vielleicht nicht so sehr darum, die Menschen dort zu bedauern, ihren weiteren Abgang zu befürchten und zu meinen, dass sie eigentlich die Pflicht hätten, die christliche Stellung zu halten, und ihnen hie und da ein bisschen Geld oder sonstige Almosen zu schicken, nett und solidarisch an sie zu denken.
Die Menschen in Palästina brauchen Arbeit, brauchen eine Aufgabe und keine Almosen. Warum also nicht hinfahren, als Pilger, vor allem aber als Mitmenschen nicht nur um die heiligen Steine zu besuchen, sondern um der Heiligung der menschlichen Würde willen.
Übrigens: Das Risiko ist nicht größer, als auf der Westautobahn von Wien nach Salzburg zu fahren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!