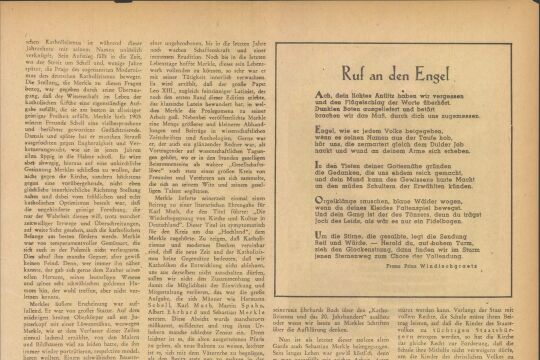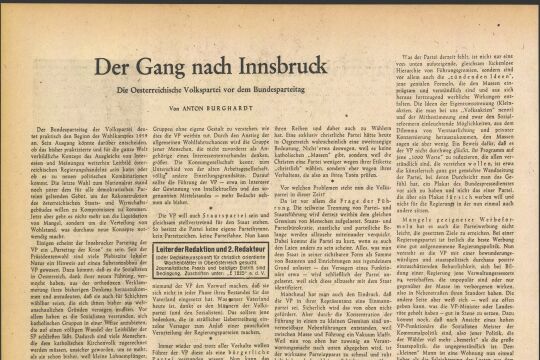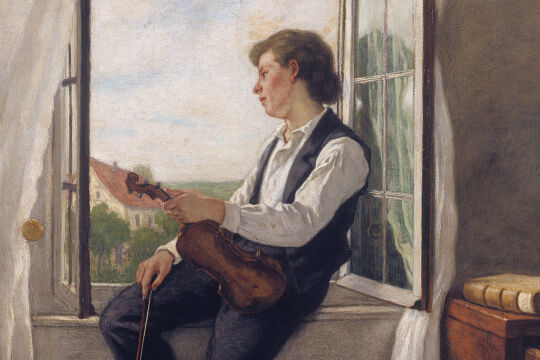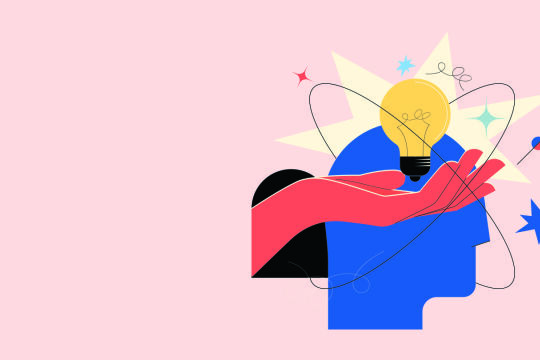Was immer die Gesellschaft nicht in den Griff bekommt, wird der Schule übertragen. Das kann die beste aller denkbaren Schulen nicht leisten. (Stefan Hopmann)
"Wir müssten auf irregeleitete Leistungserwartungen, PISA-Wahn und Kompetenzgaukelei verzichten. Und Gesellschaft sowie Politik müssten soziale Spannungen dort bekämpfen, wo sie entstehen."
Non vitae, sed scholae discimus", seufzte Seneca 62 n. Chr. in einem Brief an seinen Freund Lucilius: "Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir!" Er brachte damit eine von vielen Zeitgenossen geteilte Erfahrung auf den Begriff. "Lebensweisheit" und "Schulweisheit" trennen Welten. Zu dieser Zeit hatte sich das Lehrgefüge schulischer Bildung bereits in feste Bahnen gefügt, die Septem Artes Liberales (die sieben freien Künste), welche die Schule noch gut 1500 weitere Jahre prägen sollten. Selbst in unserer heutigen, anscheinend so schnelllebigen Zeit sind die Grundstrukturen des Lehrplans mehr als 200 Jahre alt. Doch genau in dieser Beharrlichkeit lag und liegt die Stärke der Schule. Das Leben ist offen, ungewiss und vielfältig. Schulweisheit ist begrenzt, bestimmt und eindeutig. Gerade dadurch wird sie lehr-und lernbar und sichert so die Generationen übergreifende Verständigung.
Der "Riss zwischen Schule und Alltagsleben" (Hildebrand 1867) beschäftigte seitdem und bis in die Gegenwart. Immer wieder wird gefordert, die Schule zu "öffnen" und das Leben hinein zu lassen. Entgegen allen Verdächtigungen war und ist Schule solchen Aufforderungen allzeit bereitwillig gefolgt. Keine neue Technologie, keine gesellschaftliche Bewegung, keine Flügelschläge des Zeitgeistes, die sich nicht umgehend in der Schule wiedergefunden hätten so wie in jüngster Zeit die "Digitalisierung". Freilich meist ohne etwas an deren Altbeständen zu ändern und auch nur zeitlich begrenzt: Sobald das Neue alltäglich geworden ist, wird es durch "neueste Neuigkeiten" verdrängt.
Schon dieses Entgegenkommen löste wiederholt Sorge vor der "Überbürdung"(Lorinser 1836) der Schülerinnen und Schüler aus. Auch heutzutage könnte man mit den gesammelten Lehrplanforderungen eines beliebigen Monats österreichischer Tageszeitungen die Schuldauer getrost verdoppeln. Die Bildungspolitik versucht dem mit immer neuen Schulinhalten Rechnung zu tragen, gelegentlich unterbrochen von dem immer vergeblichen Versprechen, demnächst die Lehrpläne gehörig zu entrümpeln.
Fatal wird der Druck, wenn obendrein versucht wird, gleichförmige Wissensaneignung abzusichern. Solche Bestrebungen sind noch immer gescheitert. Auch gegenwärtig wird unter der Überschrift "Kompetenzorientierung" eine Breite und Regelmäßigkeit des Wissenserwerbs suggeriert, die es weder je gegeben hat, noch je geben wird. Sie widerspricht der Vielfalt des Lehrens, der Lernwege und der Individualitäten. Vor allem pervertiert sie die sinnstiftende Idee des schulischen Lehrgefüges: Sein Zweck ist nicht die unbegrenzte Anhäufung von Wissen, sondern die exemplarische Einführung in Modi des Weltverstehens (sprachlich, mathematisch, naturwissenschaftlich, ästhetisch, religiös usw.)."Multum, non multa" hieß es dazu schon bei Plinius dem Jüngeren rund 100 n. Chr. Weniges gründlich ist besser als Vieles oberflächlich.
Ausgrenzung
Der heute durch Globalisierungsängste getriebene und durch PISA &Co. untermalte Drang zu überzogenen Erwartungen an den Wissenserwerb bedroht zu dem die zweite grundlegende Aufgabe der Schule, ihren Erziehungsauftrag. Schon Aristoteles wollte aus gutem Grund nicht Spitzenleistungen als Hauptzweck der Schule, sondern Tugend als Gemeinschaftsfähigkeit. Diese Grundidee war auch Ziel der Einführung der Pflichtschulen im Gefolge von Reformation und Gegenreformation. Es ging darum, die Untertanen in Kirche und Staat einzugemeinden. Nichts anderes trieb Friedrich den Großen oder Maria Theresia zur Verwandlung der Schule in eine öffentliche Anstalt.
Das zentrale Medium dieser Erziehung ist das Schulleben selbst. Dort lernt man mit anderen, die man sich nicht selbst ausgewählt hat, an Sachen, die man sich nicht unbedingt gewünscht hat, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, das man nicht allein bestimmt hat. Das gelingt vor allem dann, wie nicht erst neuere Schulforschung belegt, wenn es eine klare Schulkultur gibt, die Gemeinschaft nach innen fördert und nach außen zeigt. Gegenseitiger Respekt, Hilfsbereitschaft und Vertrauen schaffen das Selbstvertrauen, lernen zu können, was man lernen will.
Solange es Schule gibt, war diese Kultivierung des gemeinsamen Lernens nie einfach. Je bunter die Schülerinnen und Schüler, je ungewisser die Zeitumstände, je größer die sozialen Unterschiede, umso schwieriger ist es, solche gemeinsame Erfahrung zu ermöglichen. Zudem legt auch in diesem Bereich die Politik ihre unerledigten Aufgaben vor der Schulpforte ab: die Folgen von Armut und Familienelend, die Spannungen zwischen Kulturen und Religionen, jedwede Gewalt, jedwede Sucht, jedwede Gefährdung sozialen Friedens. Was immer die Gesellschaft nicht in den Griff bekommt, wird der Schule übertragen. Das kann die beste aller denkbaren Schulen nicht leisten.
So folgt auf die Überbürdung der Schülerinnen und Schüler die Überforderung der Lehrkräfte, die auch sie an die Grenzen ihrer Möglichkeiten treibt. Verlangt wird nicht weniger als die Quadratur des Kreises: Ungebremste Konkurrenz bei gleichzeitiger Eingemeindung aller in Schule und Gesellschaft. Beides zugleich ist allenfalls jenen zuzutrauen, die selbst oder von Haus aus die Ressourcen mitbringen, Wissenserwerb und Kultivierung aufeinander abzustimmen. Eltern, die es sich leisten können, wählen für ihren Nachwuchs Schulen, wo das möglich ist, und diese Schulen nehmen bevorzugt jene auf, mit denen das möglich wird. Allen übrigen droht, mit Schulen vorliebnehmen zu müssen, die sich entweder auf den beschleunigten Erwerb oberflächlicher Testkompetenzen spezialisieren oder notgedrungen damit begnügen, irgendwie den Unterlegenen im Schulwettbewerb elementare Schulkenntnisse und Sitten einzutrichtern. Dadurch wird die Schule selbst zur Grenze, die den Privilegierten den Durchmarsch erlaubt und den anderen den vollen Zutritt zur Gesellschaft von vornherein verwehrt.
An der Grenze
Das ist in vielen Teilen der Welt schon längst Realität. Soweit muss es bei uns nicht gehen. Dies zu verhindern erfordert aber eine radikale Wende. Zum einen müssten wir auf irregeleitete Leistungserwartungen, PISA-Wahn und Kompetenzgaukelei verzichten. Es muss allen möglich werden, in der Schule zu lernen, was es für die Schule braucht. Zum andern müssten Gesellschaft und Politik Armutsfolgen und soziale Spannungen dort bekämpfen, wo sie entstehen, anstatt sie der Schule aufzubürden. Die gegenwärtige Elendspolitik gegen Flüchtlinge und anderes Fremde, gegenüber Kinderarmut und sozialer Not lässt gepaart mit dem bildungspolitischen Starrsinn aller Parteien befürchten, dass es dazu nicht kommen wird.
Die Schule kann sich aber auch selbst abgrenzen, um ihrem Auftrag gerecht werden zu können. Ohne Selbstbeschränkung ist sie immer in Gefahr, wie ein Brennglas gesellschaftliche Spannungen zu bündeln. Solche Zuspitzung gesellschaftlicher Deformationen hat Geza Ottlik 1959 in seinem Roman "Schule an der Grenze" schonungslos in einer Art beschrieben, die an Musils Törleß (1906) oder Torbergs Schüler Gerber (1930) erinnert. Sie repräsentieren literarische Grenzfälle dessen, was jede Schule anrichten kann, wenn dort Anpassungsdruck und Leistungserwartungen ausagiert, Andersartige und Schwächere unterdrückt werden. Solches geschieht vor allem dann, wenn Übergriffe durch gesellschaftlich salonfähige Zuschreibungen gedeckt erscheinen, etwa durch Abwertung anderer Religionen, Kulturen, Begabungen, Schichten oder Lebensformen. Dann wird das einzelne Kind, das ein Kopftuch trägt, anders betet oder singt, anders spricht, anderes kann oder anders lebt, stellvertretend für die Unfähigkeit der jeweiligen Umgebung bestraft, Abweichungen angstfrei auszuhalten oder gar als Zugewinn zu erleben. Wer solches toleriert oder sogar durch politische oder pädagogische Vorgaben legitim erscheinen lässt, verantwortet Gewalt gegen Schutzbefohlene. Wie in der übrigen Gesellschaft beweist sich die Qualität einer Schule im Umgang mit den schwächsten ihrer Glieder.
Schule muss sich gegenüber solchen Zumutungen abgrenzen. Jede einzelne Schule darf, ja muss ihre eigene Identität haben, die in der Schulgemeinschaft selbst verankert ist: So gehen wir miteinander um, so respektieren wir einander, so helfen wir einander, und das erwarten wir.
Schulisches Eigenleben
Wie das im Einzelfall zu erreichen ist, wird von Schule zu Schule verschieden sein. Traditionsschulen stehen vor anderen Herausforderungen als neue Bildungszentren, ländliche Schulen vor anderen als innerstädtische, homogene Schulen vor anderen als heterogene usw. Bei den einen werden vielleicht Musik, Kultur oder Bewegung im Vordergrund stehen, bei anderen Ökologie, Technologie oder Sprachenvielfalt. An einer Schule wird es zunächst darum gehen, Gemeinschaft für alle sichtbar herzustellen, an einer anderen darum, Freiräume zu stärken. Der Möglichkeiten sind viele.
Klingt wie eine Utopie? Nein, schaut man sich in der Welt oder in Österreich nach Schulen um, die Großartiges leisten, wird man fast immer auf Schulen treffen, denen ein solches Eigenleben gelungen ist. Denn -wie es richtig heißen müsste: Dadurch wie wir in der Schule lernen, lernen wir für das Leben.