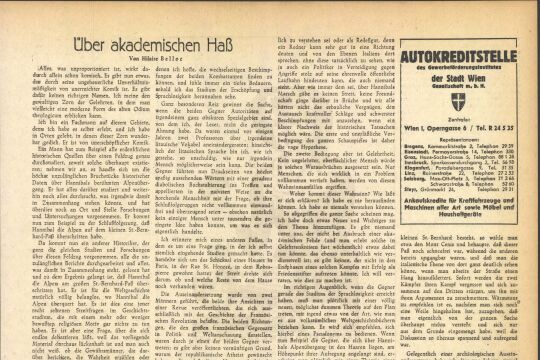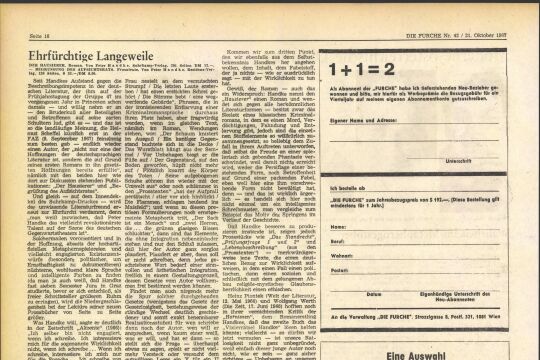Das Grausige und das Grausliche
Josef Haslinger schrieb einen Roman des Zorns über die heruntergekommene SPÖ, doch seine Diagnose hat einen Beigeschmack von Autopsiebericht.
Josef Haslinger schrieb einen Roman des Zorns über die heruntergekommene SPÖ, doch seine Diagnose hat einen Beigeschmack von Autopsiebericht.
Die Leiche im Keller lebt, isst, scheidet aus und macht womöglich zu viel Lärm. Vor allem in Anbetracht des alten jüdischen Journalisten, der täglich vorbeigeht und das Haus mit verdächtiger Aufmerksamkeit mustert. Dabei ist die Familie der Leiche im Keller von untadeliger politischer Korrektheit. Wenigstens zum Teil.
Josef Haslinger versteht sich auf das kunstvolle Verflechten von Schicksalen. Er lässt Handlungen lang nebeneinander her laufen und vermittelt dem Leser die Gewissheit, dass sie sich irgendwann treffen werden. Er lädt Privates politisch auf und verpackt Politisches in spannende Handlungen. Und er weiß, wie man schockiert, wie man Grausiges und Grausliches so mischt, dass der Leser nicht mit dem Lesen aufhört, und wie man Bücher schreibt, die verfilmt werden.
Fünf Jahre nach dem Roman "Opernball" erschien nun "Das Vaterspiel". Auf die filmische Umsetzung des Computerspiels, mit dem der bislang erfolglose Rupert den durchschlagenden Erfolg erzielt und zu Geld kommt, darf man gespannt sein. Der Spieler kann das eingescannte Bild einer nahestehenden Person auf dem Bildschirm auf alle möglichen Arten vom Leben zum Tode befördern. Dabei kann er nicht nur zwischen den Vernichtungsarten wählen, sondern auch den Grad der Gegenwehr seines Opfers einstellen.
Der Erfinder des Vernichtungsspiels ist Rupert, der eigentlich Helmut heißt. Aber da auch der Papa so heißt, bevorzugt er den Namen Rupert, auf den er über Drängen des Scheibbser Opas als Dreijähriger endlich doch noch getauft wurde. Der Scheibbser ÖVP-Opa hat auf den atheistischen Wiener SPÖ-Papa einen infernalischen Hass, der um nichts nachlässt, als der Papa Verkehrsminister wird, obwohl dies für die Familie eine Aufwertung bedeutet. Helmut seinerseits, der mit einer Visage geschlagen ist, die ihm überall den Spitznamen "der Ratz" einträgt, hat zwar mit dem Scheibbser Opa auch nichts im Sinn, aber den Papa hasst er, weil dieser, findet er nicht zu Unrecht, ein Arschloch sei. Zuerst reagiert er sich mit dem Vatervernichtungsspiel nur ab, dann wird es als Vaterspiel im Internet ein Riesenerfolg.
Wenn wir dort angelangt sind, wo die beiden Handlungen ineinander laufen, haben wir 340 Seiten Ich-Erzähler Helmut/Rupert und hundert Seiten Ich-Erzähler Jonas Shtrom gelesen, und zwar mit Interesse und Spannung und ohne uns zu langweilen, aber nur zeitweise mit dem, was man Vergnügen nennen kann. Dabei kristallisiert sich um den Faden des Ich-Erzählers Jonas das Grausige und um Helmuts Erzählfaden das Grausliche des Romans. Das Grausige ist das Zeitgeschichtliche. Da gibt es nichts, was nicht notwendig wäre. Jonas Shtroms Erzählung ist ein mehrteiliges Protokoll seiner Aussagen vor deutschen und amerikanischen Ermittlern, denen der aus Litauen stammende amerikanische Journalist berichtet, wie er als Halbwüchsiger die Ausrottung der baltischen Juden erlebte. Dabei begegnete er mehrmals einem litauischen ehemaligen Schulkollegen, der sich bei den Grausamkeiten hervorgetan hat und von dem er vermutet, dass er noch lebt. Wie Haslinger die beiden Geschichten zusammenführt, das ist schon beneidenswert erfunden.
Für das Grausliche ist Helmut zuständig. Er ist die Zentralperson jenes Erzählstranges, der den größten Teil des Romans beansprucht. Damit, dass sein Papa ein Arschloch sei, hat Helmut durchaus recht, privat wie politisch. Aber er ist auch kein größeres als fast alle anderen Politiker auch. Längst hat er die Gemeindewohnung aufgegeben und sich eine Designervilla gebaut, die vor allem beweist, dass er ein gewaltiges Repräsentationsbedürfnis, aber keinen eigenständigen Geschmack und sich weit, sehr weit von seinen roten Ursprüngen entfernt hat. Nur am 1. Mai wirft er sich in proletarische Gala, fährt auf den Rathausplatz und legt größten Wert auf die Teilnahme der Kinder, die ihm aber sehr bald nicht mehr den Gefallen tun. Vor allem aber hat er seine alternde Frau gegen eine junge Schnepfe vertauscht. Auch dazu ließe sich manches Foto einscannen. Das ist es, was der Sohn nicht verzeiht. Da ist der Wiener Opa, der Dachau überstanden hat und den sozialistischen Freiheitskämpfern vorsteht, ein anderes Kaliber. Folgerichtig wurde er längst an den Rand gedrängt und nur während der Causa Waldheim als brauchbarer Antinazi-Redner für einige Zeit wieder ausgegraben.
"Das Vaterspiel" ist ein Buch des Zorns über die heruntergekommene SPÖ. Als solches wäre es ein echter Volltreffer, gäbe es noch die Große Koalition. Unter den gegebenen Umständen wird die Diagnose des verrotteten Zustands einer Partei fast schon zum Autopsiebericht. Als Verständnishilfe dafür, warum sich Österreichs Sozialdemokratie in die Oppositionsrolle so schwer hineinfindet und warum es ihr genau an dem fehlt, was sie einst in so reichem Maß hatte, nämlich an glaubwürdigen Kämpfern gegen das zu verändernde Bestehende, funktioniert es natürlich noch immer. Droht es in die falsche Kehle zu geraten, muss man sich immer wieder daran erinnern, dass Haslinger ja an diesem Roman jahrelang geschrieben hat und dass er fertig war, als die Große Koalition ebendies auch war, aber in einem anderen Sinn. Wahrscheinlich war ihm selbst am besten bewusst, dass man seinen neuen Roman mit einigem bösen Willen auch als Fußtritt für eine am Boden liegende Partei verstehen kann.
Tatsächlich könnte er ihr sogar hilfreich sein, wenn ihn diejenigen, die jetzt dort das Sagen haben, als Porträt des Typs betrachten, der die SPÖ dahin gebracht hat, wo sie jetzt ist. Und der jetzt ein Klotz am Bein ist. Was nicht bedeutet, dass man nicht über die repräsentativen Figuren, die nunmehr die Macht haben, aus ebenso intimer Kenntnis ebenso arge oder noch viel ärgere Bücher schreiben könnte. Solche Bücher würden dringend benötigt.
Die Grauslichkeiten der Politik sind aber nicht gemeint, wenn oben vom Grauslichen der Haupterzählung die Rede ist. Vielmehr greift Haslinger auch tief in ganz andere Töpfe. Er ersinnt Krassheiten, bei denen man nicht um die Frage herumkommt, ob hier tatsächlich Wesentliches über heutiges Leben mitgeteilt wird oder ob aus dem Unbewussten drängt, was gesagt werden will. Was durchaus möglich erscheint und die Literatur schon öfters weitergebracht hat. Oder ob der Autor nicht doch ganz einfach meint, Voyeurismus verkaufsfördernd bedienen zu müssen. Es gab ja schon im "Opernball" Anzeichen für eine solche Taktik.
So oder so, die Konsistenz der Ausscheidungen eines Kriegsverbrechers bleibt uns ebenso wenig erspart wie die Effekte der atavistischen Ganzkörperbehaarung beim entkleideten Schwager oder der Stoffaustausch beim Oralsex. Josef Haslinger ist ein Autor mit einer knappen, eindringlichen Sprache. Doch die Kunst der zarten Andeutung ist seine Sache nicht.
Erzähltechnisch und sachlich vertut er sich fast nie. Dass wir schon auf Seite 159 mit aller Deutlichkeit aufgedoppelt bekommen, was uns in Kenntnis der ersten Buchbesprechungen einige Zeilen weiter oben sowieso schon dämmerte, nämlich dass Helmut den schalldichten Probenraum der Band "Die Geilen Säcke" 17 Jahre später in den USA nachbauen wird, kann als Kunstfehler gelten. Dass es Fünfeinhalb-Zoll-Disketten noch nie gegeben hat, sondern nur Fünfeinviertel-Zoll-Disketten, sollte jemand, der seinen Helden ein Computerspiel erfinden lässt, aber auch jeder Lektor, doch wissen. Einige sprachliche Grauslichkeiten wirken gerade dank der Qualität und Korrektheit von Haslingers Sprache wie kleine Ohrfeigen. Etwa, dass Helmut "den Radio" einschaltet. Aber auch die Durchsage im Flugzeug, "es gäbe einen erheblichen Rückstau" in Frankfurt, und zwar nicht im konditionalen Falle dass, sondern als Tatsachenmitteilung, gebe es, dachte ich bisher, bei einem Autor wie diesem nicht.
Dafür ist die amerikanische Begräbnisszene ein kleines Gustostück, das sich zwar mit Begräbnissen wie dem der Mama Matzerath in der "Blechtrommel" oder dem in Peter Marginters "Der tote Onkel" nicht messen kann, aber auch nicht zu verstecken braucht. Wie überhaupt die vielen und oft sehr witzigen Details "Das Vaterspiel" gar nicht beschweren, sondern das Interesse wach halten. Auch wer Stunden vorher da und dort leicht angewidert innehielt und sich fragte, ob die Schilderung der plastischen Blut- und sonstigen Spuren einer Sado-Maso-Szene, die uns zum Glück entgeht, über deren Rückstände an der Zimmerwand in der Mondscheingasse wir aber ausführlich informiert werden, notwendig sei, wird spätestens beim Lesen der letzten 150 Seiten alle Einwände beiseite schieben.
Am Ende bleibt aus, was man nun erwarten könnte. Nämlich zu dem, was äußerlich geschieht, dem Bau eines schalldichten Verstecks, der innere oder äußere politisch-moralische Diskurs. Sachlich, fast unbeteiligt, bekennt der Massenmörder im Keller seinem Helfer, was er getan hat: "Zwischendurch eine Zigarette und ein Glas Schnaps, den Rest der Zeit habe ich geschossen." Gerade das Ausbleiben dessen, was jeder erwartet, der Reflexion, der Auseinandersetzung, gibt nun dem Roman eine erstaunliche Wucht.
Ab einem bestimmten Moment gegen Ende lässt Haslinger den Leser auf infernalisch raffinierte Weise mit seinen Gedanken und Fragen allein. Dabei schlägt auch die Vatergeschichte noch einmal einen wilden Haken. Doch es gibt kein Weiterlesen mehr, nichts ist mehr zu erfahren. Man klappt das Buch zu, es läuft einem kühl über den Rücken.
Das Vaterspiel Roman von Josef Haslinger, S. Fischer Verlag, Frankfurt/M. 2000, 576 Seiten, geb., öS 336,- / E 24,40
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!