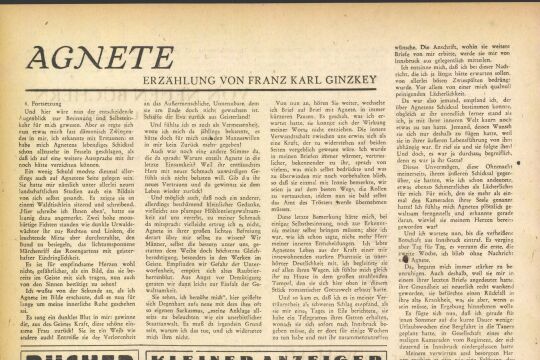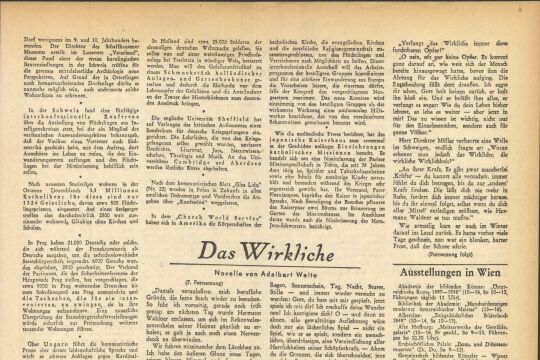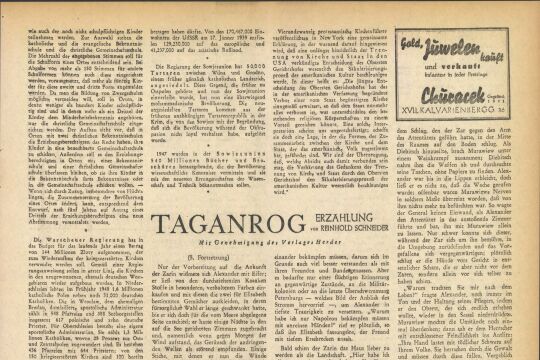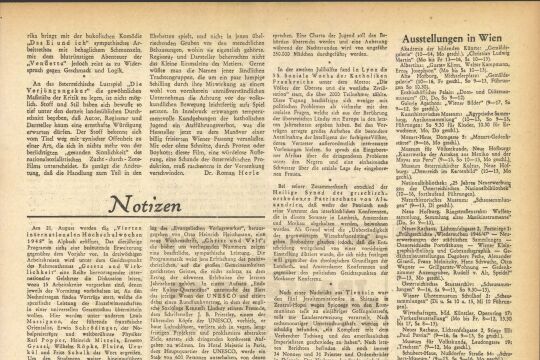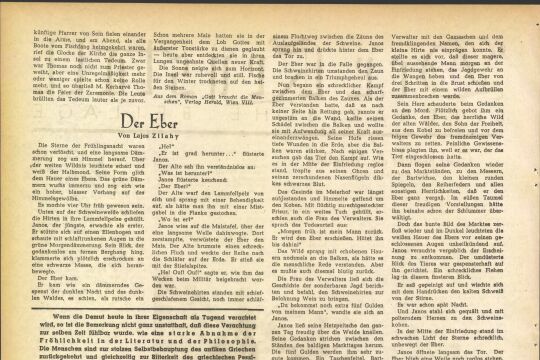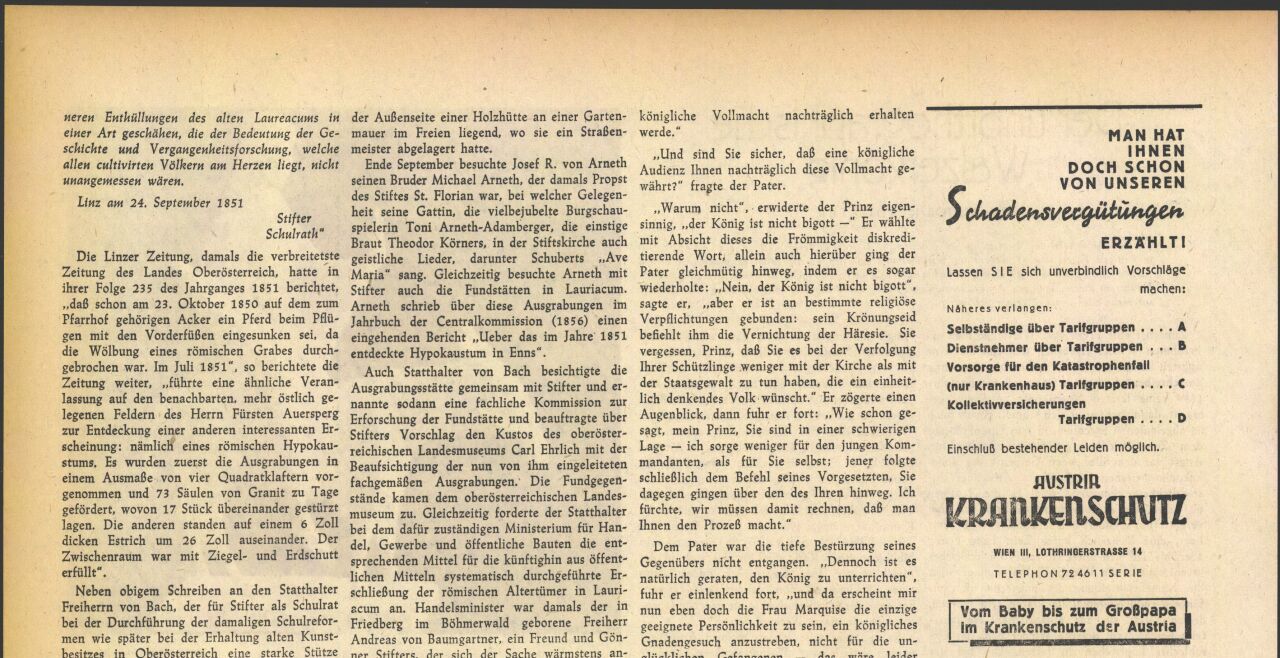
Auf verlorenem Posten
Dies ist die Geschickte einer denkwürdigen Heimkehr zu Gott. Der Prinz von Beauvau, Freidenker, Günstling der allmächtigen Marquise am Hofes des Franzosenkönigs, hat als Gouverneur aus dem Turm von Aigues-Mortes in einer Anwandlung von menschlichem Mitleid die Hugenottenfrauen freigelassen — ohne königliche Vollmacht. Wer rettet ihn vor der Ungnade des Königs? Die Marquise? Der Jesuitenpater, an den sie ihn gewiesen hat? Das nachfolgende Gespräch zwischen Prinz und Pater bereitet des Prinzen Einkehr und endgültige Heimkehr vor.(Aus „Der Turm der Beständigkeit“, Insel-Verlag 1957.)
Dies ist die Geschickte einer denkwürdigen Heimkehr zu Gott. Der Prinz von Beauvau, Freidenker, Günstling der allmächtigen Marquise am Hofes des Franzosenkönigs, hat als Gouverneur aus dem Turm von Aigues-Mortes in einer Anwandlung von menschlichem Mitleid die Hugenottenfrauen freigelassen — ohne königliche Vollmacht. Wer rettet ihn vor der Ungnade des Königs? Die Marquise? Der Jesuitenpater, an den sie ihn gewiesen hat? Das nachfolgende Gespräch zwischen Prinz und Pater bereitet des Prinzen Einkehr und endgültige Heimkehr vor.(Aus „Der Turm der Beständigkeit“, Insel-Verlag 1957.)
Der Prinz von Beauvau begab sich also zu dem Jesuitenpater, der ihn mit weltmännischer Höflichkeit, ohne sichtbare Ueberraschung, empfing. Der Prinz überreichte ihm ein Billett, das ihm die Marquise als Legitimation übergeben hatte — der Pater erbrach es und las mit halblauter Stimme: „Von tiefer Sorge um die Bewahrung unseres heiligen Glaubens erfüllt und überglücklich, der heiligen Kirche einen kleinen Dienst erweisen zu können —“ Der Pater hielt inne und lachte hell auf: „Das ist die Frau Marquise, ja das ist wieder einmal ganz die Frau Marquise“, rief er sichtlich amüsiert — es war, als sage er: da versucht sie also schon wieder, mich anzuschwindeln! Dann, nachdem er den Brief schweigend zu Ende gelesen, sagte er: „Sie befinden sich tatsächlich in einer schwierigen Lage, mein Prinz, hat Ihnen denn die Frau Marquise gar nichts versprechen können?“
„Sie hat mir Ihre Hilfe versprochen, sonst nichts“, erwiderte der Prinz gereizten Tones.
„Ja die Frau Marquise, die Frau Marquise“, sagte der Pater seufzend, „sie ist nicht von ihren Wünschen abzubringen, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat.“ Ohne daß irgendeine Erklärung erfolgte, hatte der Prinz die Ueberzeugung, daß seine Gönnerin mit der Mission, die sie 'ihm hier zugeschoben, ihre eigene Absolution bei dem Pater zu fördern gedachte und daß jener dies auch sehr wohl verstanden hatte, obwohl er kein Wort darüber verlor — stumm faltete er das Billett der Marquise zusammen. Dann sagte er.: „Sie fühlen sich selbst zu dem protestantischen Glauben hingezogen, mein Prinz, nicht wahr?“
„Nein, im Gegenteil, ich bin Freidenker, aber ich habe durch die Gefangenen von AiguesMortes gesehen, wie es um gläubige Menschen ist“, erwiderte der Prinz — er fühlte trotz der Beklemmung seiner Lage die gereizte Versuchung, dem Jesuiten gegenüber die eindrucksvolle Haltung der Häretiker zu betonen.
Der Pater verstand die Herausforderung, bewahrte aber unerschütterliche Gelassenheit. „Und wie lautete der Befehl, den Sie in Aigues-Mortes hinterließen?“ fragte er mit sachlicher Bestimmtheit.
Der Prinz fühlte den lebhaften Anreiz, die liebenswürdige Höflichkeit des Jesuiten zu trüben. „Ich habe als Gouverneur der Landschaft befohlen, die unglücklichen Gefangenen sofort zu entlassen“, sagte er hochmütig — er genoß in diesem Augenblick noch einmal den Triumph seiner mächtigen Stellung. Allein der Pater tat ihm nicht den Gefallen, sich wie die Marquise zu entsetzen.
„Sehr begreiflich, mein Prinz“, sagte er wohlwollend, „sehr begreiflich vom Standpunkt der Menschlichkeit her, ich verstehe Sie vollkommen.“ Dann mit feinem Lächeln: „Auch wir Jesuiten haben schließlich die letzten Entwicklungen des Geistes nicht ganz ohne Vorteil beobachtet. Dieser Rationalismus, so verhängnisvoll er sich auch auf die Religion auswirkt, er mußte kommen — die Religion allein wurde mit dem Fanatismus nicht fertig.“
Der Prinz fiel von einem Erstaunen ins andere, indessen fuhr der Pater freimütig fort: „Ich achte also Ihren zu Aigues-Mortes gegebenen Befehl durchaus, mein Prinz, nur durfte er natürlich nicht vollzogen werden, da ihm die königliche Vollmacht fehlte.“
„Aber er ist vollzogen worden“, sagte der Prinz mit Nachdruck. „Der junge Kommandant vollzog meinen Befehl selbstverständlich, es bedurfte nur meines Versprechens, daß er die königliche Vollmacht nachträglich erhalten werde.“
„Und sind Sie sicher, daß eine königliche Audienz Ihnen nachträglich diese Vollmacht gewährt?“ fragte der Pater.
„Warum nicht“, erwiderte der Prinz eigensinnig, „der König ist nicht bigott —“ Er wählte mit Absicht dieses die Frömmigkeit diskreditierende Wort, allein auch hierüber ging der Pater gleichmütig hinweg, indem er es sogar wiederholte: „Nein, der König ist nicht bigott“, sagte er, „aber er ist an bestimmte religiöse Verpflichtungen gebunden: sein Krönungseid befiehlt ihm die Vernichtung der Häresie. Sie vergessen, Prinz, daß Sie es bei der Verfolgung Ihrer Schützlinge weniger mit der Kirche als mit der Staatsgewalt zu tun haben, die ein einheitlich denkendes Volk wünscht.“ Er zögerte einen Augenblick, dann fuhr er fort: „Wie schon gesagt, mein Prinz, Sie sind in einer schwierigen Lage — ich sorge weniger für den jungen Kommandanten, als für Sie selbst; jener folgte schließlich dem Befehl seines Vorgesetzten, Sie dagegen gingen über den des Ihren hinweg. Ich fürchte, wir müssen damit rechnen, daß man Ihnen den Prozeß macht.“
Dem Pater war die tiefe Bestürzung seines Gegenübers nicht entgangen. „Dennoch ist es natürlich geraten, den König zu unterrichten“, fuhr er einlenkend fort, „und da erscheint mir nun eben doch die Frau Marquise die einzige geeignete Persönlichkeit zu sein, ein königliches Gnadengesuch anzustreben, nicht für die unglücklichen Gefangenen — da; wäre leider zwecklos —, aber für Sie selbst.“ Er hielt inne, denn der Prinz schüttelte mit einem unbeschreiblichen Ausdruck den Kopf.
„Besteht etwa von Ihrer Seite her ein Widerstand gegen die Hilfe der Frau Marquise?“ fragte der Pater betroffen.
Der Prinz war einige Augenblick lang still, dann sagte er mit gepreßter Stimme: „Ja, ich habe Widerstände.“ Was er bisher nur dunkel geahnt, war plötzlich zur absoluten Gewißheit geworden: der Schatten von Aigues-Mortes hatte auch seine Beziehung zur Marquise erreicht! Jene beunruhigende Empfindung, die ihn beim Betreten ihrer Gemächer — nein, schon in der Kutsche bei der Rückfahrt nach Paris — flüchtig überfallen hatte, brach mit übergroßer Klarheit in sein Bewußtsein ein: er konnte, er durfte diese Frau nicht mehr um ihre Vermittlung bitten.
Der Pater, der ihm mit gesenkten Augen gegenüberstand, sah mit einem schnellen, intelligenten Blick auf. „Ich verstehe“, sagte er hellhörig, „das Erlebnis von Aigues-Mortes hat Sie nicht nur menschlich erschüttert, sondern auch innerlich gewandelt: Sie wollen sich lieber Gott anvertrauen —“ Er hielt inne, denn der Prinz schlug plötzlich beide Hände vors Gesicht, er fühlte sich ratlos einem Prozeß ausgeliefert, der ihn langsam, aber sicher, jeder Hoffnung beraubte.
Einige Minuten herrschte Schweigen zwischen den beiden Männern, dann sagte der Prinz: „Nein, eben das vermag ich nicht. Ich haW in Aigues-Mortes den Glauben an den Atheismus verloren. Ich habe erlebt, daß es noch christlichen Glauben gibt, aber ich selbst stehe diesem Glauben fern.“ Dann, mit verzweifelter Entschlossenheit: „Also, ich muß den König sprechen — Pater, gibt es denn von Ihnen, ich meine von Ihrem Orden aus, keine Möglichkeit der Rettung?“
Der Pater sah den Prinzen mit ehrlichem Mitgefühl an. „Ich würde Ihnen am liebsten raten, außer Landes zu gehen“, sagte er, „und zwar sofort. Der Kaplan war bei dem Ereignis von Aigues-Mortes zugegen, niemand kann ihm einen Vorwurf machen, wenn er seine kirchlichen Vorgesetzten unterrichtet, und Sie werden selbst wissen, Prinz, welche Haltung unsere hohen französischen Kirchenfürsten den Andersgläubigen gegenüber einnehmen, obgleich sie fast alle mit der ungläubigen Philosophie kokettieren. Und doch sind diese Kirchenfürsten schon längst nicht mehr die letztlich entscheidenden — ich glaube, Prinz, Sie verkennen immer wieder die wirkliche Lage. Wir haben es mit der Staatsgewalt zu tun!“
Nun hielt sich der Prinz nicht länger: alle in der Gesellschaft umlaufenden Gerüchte über eine fast märchenhafte Macht des Jesuitenordens brachen sich in ihm Bahn. „Aber was bedeutet denn der Staat“, rief er, „wenn die Meinung des mächtigen Ordens, den Sie, Pater, hier vertreten, doch auf Toleranz lautet!“
„Toleranz ist nicht die Meinung des Ordens, den ich hier vertrete“, erwiderte der Pater, „und sie wird es niemals sein. Es geht aber auch gar nicht um Toleranz, sondern um etwas viel Feineres und Tieferes: es geht um Menschlichkeit und Erbarmen, die man auch denjenigen schuldet, deren Glauben man bekämpft. Doch die Stunde des Erbarmens hat in diesem Land noch nicht geschlagen, aber sie wird kommen,vielleicht in hundert, vielleicht erst in zwei-oder dreihundert Jahren — unser Gespräch hier —“ er lächelte — „spielt sozusagen in zukünftigen Jahrhunderten. Kommen werden diese Jahrhunderte, da man uns den schwersten Vorwurf wegen Ihrer Gefangenen machen wird: alle ihres Glaubens wegen an die Galeeren Geschmiedeten rudern das Schifflein Petri Stürmen der Anklage entgegen, obwohl der Heilige Vater wissen ließ, daß die hiesigen Methoden nicht diejenigen Christi seien und man die Abgefallenen in die Kirche führen und nicht hineinschleifen solle. Allein die gallikanischen Freiheiten fühlen sich nicht verpflichtet, dieser väterlichen Stimme zu gehorchen.“
„Aber man sagt doch Ihrem Orden nach, er sei so klug und mächtig, daß er alles durchzusetzen vermöge“, beharrte der Prinz naiv, er klammerte sich jetzt förmlich an sein Gegenüber.
„Nein, wir können gar nichts durchsetzen,“ erwiderte der Pater, „nicht einmal die bescheidenste sittliche Ordnung am Hofe des aller-christlichsten Königs, wie der uns hier beschäftigende Fall der Frau Marquise zeigt. Die Wahrheit ist, daß wir nicht minder gefährdet sind als Sie, mein Prinz —“, er zögerte flüchtig, dann fuhr er lächelnd fort, „nein, wirklich, Prinz, unsere Position ist der Ihren gar nicht unähnlich: es laufen schwere Intrigen gegen uns, Intrigen, die bis nach Rom gehen, um die Aufhebung unseres Ordens zu betreiben. Ich würde mich durchaus nicht wundern, wenn auch wir bald dieses Land verlassen müßten.“
Wieder fiel der Prinz von einem Erstaunen ins andere. „So stünden also auch Sie auf verlorenem Posten?“ sagte er zweifelnd.
„Selbstverständlich — der Christ steht immer auf verlorenem Posten“, erwiderte der Pater fröhlich, „und so ist es auch ganz in der Ordnung: auf verlorenem Posten stehen, das heißt dort stehen, wo auch Christus hier auf Erden stand. Gefährlich wird die Sache erst, wenn man als Christ die Fahne dieser Welt ergreift, um sich zu retten.“
„Aber ich kann doch nur das Panier der Welt ergreifen“, rief der Prinz verzweifelt, „denn diese Welt ist mir sehr, sehr lieb — ich habe keine andere zu veilieren!“ Er war am Ende seiner Fassung angekommen. Der Pater sah ihn mit ehrlicher Besorgnis an. Er schätzte innerlich die zur Verfügung stehende Kraft des anderen ab — der erfahrene Menschenkenner sah, daß sie, soweit irdische Augen in Frage kamen, nicht ausreichte.
„Gut“, sagte er, „retten wir also die Welt, mein Prinz, aber es geht wirklich nur durch die Frau Marquise: ihre Macht über den König ist grenzenlos, nicht dieser, sondern sie ist der wahre Regent dieses Landes. Warten Sie einen Augenblick —.“ Er warf hastig einige Zeilen aufs Papier, das er dem Prinzen reichte. Und als dieser zögerte, es anzunehmen, setzte er lächelnd hinzu: „Es ist keine Intrige mit diesen Zeilen verbunden, wie Sie dem Jesuiten gegenüber offenbar glauben — ich bin in der glücklichen Lage, der Frau Marquise ganz einfach versichern zu können, daß sie der Kirche, im Gegensatz zu ihrer eigenen Meinung, einen Dienst erweist, wenn sie Ihre Bitte beim König befürwortet — Sie wissen ja: der Kirche der Zukunft.“