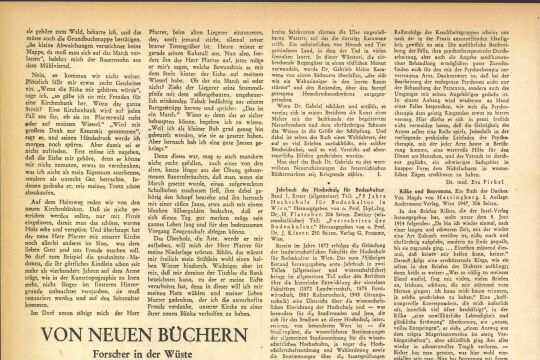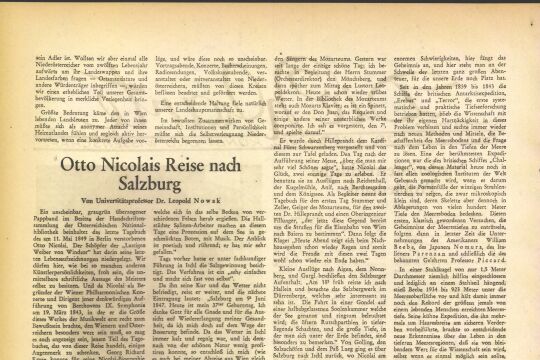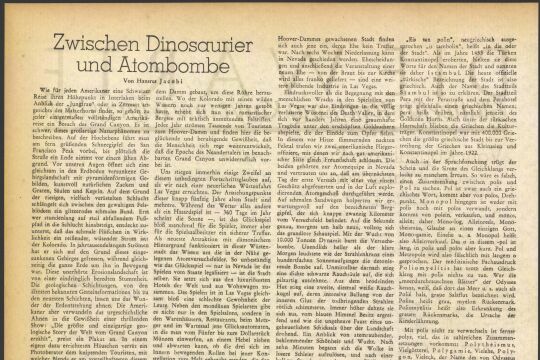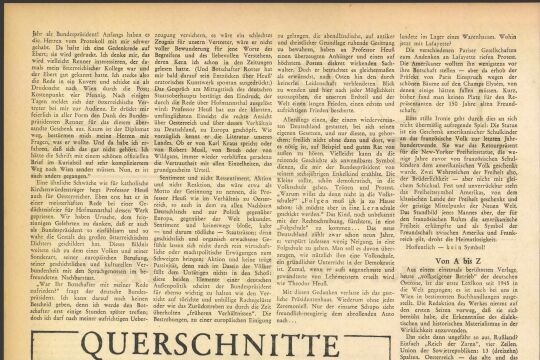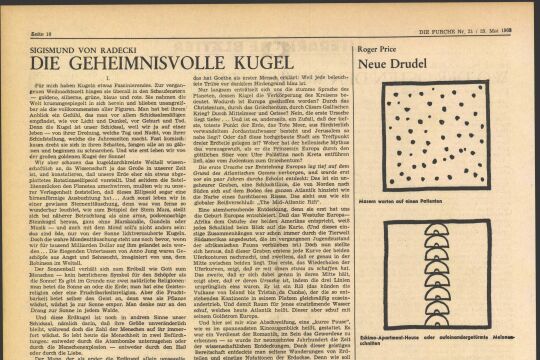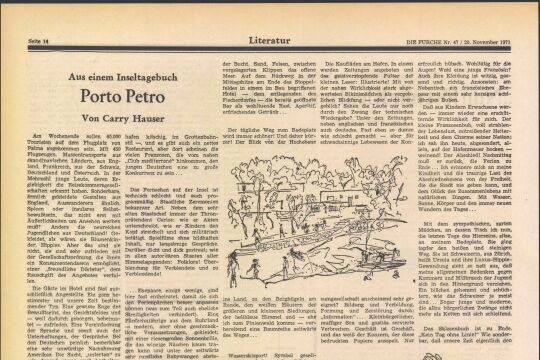Leuchttürme in der Literatur: Wachsames Auge, rettendes Licht
Sie sind das Licht in der Brandung und ein Sehnsuchtsziel, aber auch ein Ort der Einsamkeit und des Wahnsinns ‒ ein literarischer Streifzug durch die Welt der Leuchttürme.
Sie sind das Licht in der Brandung und ein Sehnsuchtsziel, aber auch ein Ort der Einsamkeit und des Wahnsinns ‒ ein literarischer Streifzug durch die Welt der Leuchttürme.
Von Leuchttürmen geht eine magische Wirkung aus. Je extremer ihr Standort, desto stärker ihr Bann. Ihre Geschichte reicht mehr als 2000 Jahre zurück, bis zum prächtigen Pharos von Alexandria. Vielleicht aber auch bis zum Koloss von Rhodos, dessen eine Hand angeblich ein Leuchtfeuer hielt. Beide Monumente zählen zu den sieben Weltwundern der Antike.
Leuchttürme zeugen von herrschaftlicher Prestigepolitik und kühner Ingenieursleistung. Sie sind rettende Orientierungspunkte und als solche Träger einer starken Symbolik. Bis ins späte 20. Jahrhundert sorgten speziell ausgebildete Wärter für den klaglosen Betrieb der Leuchtfeuer, heute sind die Anlagen vollautomatisiert. Leuchtturmwärter galten als Ikonen der Wachsamkeit – und als Heroen der Einsamkeit. Die Isolation auf hoher See erforderte ein besonders robustes Naturell und auch einigen Mut, denn die Ablöse erfolgte durch Abseilen vom Turm auf ein Boot. Schlechtwetter konnte den Schichtwechsel gefährlich verzögern.
Aus diesem Motiv-Fundus weiß die Literatur ertragreich zu schöpfen. Als informative Einführung sei der Band „Wächter der See“ des Briten R. G. Grant empfohlen. Seine Geschichte der Leuchttürme (übersetzt von Heinrich Degen; Dumont 2018) ist großzügig bebildert. Historische Darstellungen, Konstruktionspläne, Aufrisse und Fotografien vermitteln ein imposantes Bild dieser Wunderwelt der Technik. Kapitel zum gefahrvollen Leuchtturmbau, zur Lichttechnik und zum Leben der Wärter ergänzen die Chronik. Grants Fazit: „Leuchttürme sind weniger Ausdruck menschlicher Dominanz über die Natur als vielmehr ein Hinweis auf menschliche Zerbrechlichkeit und Einsamkeit angesichts elementarer Naturgewalten.“
Leuchttürme am Ende der Welt
Eine gute Einstimmung bietet auch der „Kleine Atlas der Leuchttürme am Ende der Welt“ des Spaniers José Luis González Macías (übersetzt von Kirsten Brandt; mare 2023). Die Karten und Bilder stammen vom Autor selbst, einem Grafikdesigner. Sein Atlas wurde 2020 als schönstes Buch Spaniens prämiert. In kompakten Kurzporträts werden Technik und Architektur der Türme ebenso gewürdigt wie deren Erbauer und Wärter (und ja, es gab auch Wärterinnen). Macías rückt die abgelegenen Felsenleuchttürme in den Fokus: „Es liegt etwas Schönes und Wildes in diesen unmöglichen Bauwerken.“ Am „Ende der Welt“ stehen sie, fernab der Zivilisation. Etwa jener von San Juan de Salvamento auf der Isla de los Estados. Ein kleines Holzhaus nur, den Stürmen Patagoniens hielt es nicht stand. Den Einzug in die Weltliteratur schaffte es aber doch. Jules Verne hat das Bauwerk nicht gesehen, aber 1906 als „Leuchtturm am Ende der Welt“ verewigt. Sein Roman handelt von einem tödlichen Kräftemessen zwischen Leuchtturmwärtern und Piraten.
Das Meer, die übermächtige Geliebte
Virginia Woolf hingegen kannte das anregende Modell für ihren Roman „To the Lighthouse“ (1927; dt. Zum Leuchtturm). Es steht in der Bucht von St. Yves, wo Woolf mit ihrer Familie die Sommer verbrachte. Erinnerungen an diese Zeit und an innerfamiliäre Spannungen fließen in den Roman ein. Die Autorin verlegt den Schauplatz auf die schottische Isle of Skye. Dort haben die kinderreichen Ramseys ihren Sommersitz – und einen Leuchtturm im Blickfeld. Der bleibt das unerreichbare Sehnsuchtsziel von Sohn James. Denn der Vater schmettert jeden Ausflugswunsch ab: das Wetter würde umschlagen. Nach einer Zäsur von zehn Jahren (Erster Weltkrieg, ein Sohn fällt an der Front, die Mutter und eine Tochter sterben) holen Vater und Sohn die Fahrt zum Leuchtturm nach: „Da ragte er auf, kahl und gerade, gleißend weiß und schwarz […]. Das war also der Leuchtturm, ja? Nein, der andere war ebensogut der Leuchtturm. Denn nichts war einfach nur ein und dasselbe.“ Die Wahrnehmungen und Gedanken der Figuren bilden einen elegischen Bewusstseinsstrom. Unbeständigkeit, Verlust und Tod sind die bestimmenden Themen. Das mittlere Romankapitel, „Time passes“, ist dem unumkehrbaren Lauf der Zeit gewidmet. Die französische Autorin Cécile Wajsbrot greift das Kapitel im Roman „Nevermore“ (Wallstein 2021) auf, einem nächsten Klagelied über das Verschwinden und über die Prozesshaftigkeit der Wahrnehmung.
Wajsbrot hegt eine besondere Beziehung zu Leuchttürmen. Ihre Erzählung „Im Lichtstrahl des Leuchtturms“ (in „Nocturnes“, Zulma 2002) handelt vom Dilemma eines Wärters, der im Licht des Leuchtfeuers ein mysteriöses Schiff entdeckt. Es bewegt sich nicht von der Stelle, sendet kein Notsignal, ist per Funk nicht erreichbar. Vergeblich erstattet er Meldung, die Kontrollbasis reagiert nicht. Seinem Drang zu handeln steht das eherne Gebot entgegen, den Posten unter keinen Umständen zu verlassen. Die Szenerie hat etwas Irreales, gemahnt an die Unerlösten eines Geisterschiffs: Die weißen Segel scheinen zu phosphoreszieren, eine Gestalt von „schauriger Bleichheit“ spukt kurz übers Deck. Das Schiff ist real, und es sinkt. Sein Rätsel wird nicht gelöst. Der Wärter erwägt einen Berufswechsel. Doch das Vergessen ist Illusion, und das Meer eine übermächtige Geliebte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!