Kräftige Farben und überraschende Pointen dominieren die Neuinszenierung von "Wiener Blut“ in der Volksoper. Der sprichwörtliche Wiener Charme tönt nur aus dem Orchestergraben.
Noch einmal, so war es der Wunsch der Prinzipalin des Theaters an der Wien, Alexandrine von Schönerer, sollte der Walzerkönig eine Operette schreiben, obwohl er schon vorher diesem Genre nur wenig abgewinnen konnte. "Es kommt mir schwer an, mich wieder an die gemeine Dudelei gewöhnen zu müssen“, klagte er über die Mühsal des Operettenkomponierens.
Freilich, wirklich Glück hatte die Schönerer nicht, denn Johann Strauß stimmte nur zu, dass man Teile aus seinem bisherigen Werk für ein neues Stück verwenden dürfe, wie es dann auch Adolf Müller tat. Grund dafür war, dass Strauß bereits am Ende seines Lebens war, außerdem konnte er sich mit der Idee eines wienerischen Stoffes wenig anfreunden. Ein französisches Sujet, mit Hermann Bahr als Librettisten, wäre ihm sympathischer gewesen. Aber daraus wurde nichts.
Plakative Pointen
Strauß starb noch vor der wenig erfolgreichen Uraufführung im Wiener Carltheater. Erst mit der zweiten Aufführungsserie im Theater an der Wien trat "Wiener Blut“ seinen bis heute andauernden Siegeszug an.
Die szenische Realisierung dieser Operette, die sich in der Hauptsache um persönliche Verwicklungen dreht, die scheinbar diplomatisch hochgespielt werden, hat ihre Tücken. Zumal dann, wenn man sich weniger mit der aus diesem Sujet sprechenden Wiener Lebensart auseinandersetzt, weil man anstelle dessen mit plakativen Pointen überraschen will. So lässt Regisseur Thomas Enzinger im Schlussbild (Bühnenbild und Kostüme: Toto) die legendenumrankte Hietzinger "Remasuri“ (Trubel) in einer von Straußen(!) dominierten Landschaft spielen, deutet die Lauben zu Straußeneiern um. Eine plumpe Anspielung, dass Fürst Ypsheim und Graf Zedlau ihre diplomatische Kunst - wenigstens, was Privates anlangt - auf die sprichwörtliche Vogelstrauß-Politik beschränken.
Überhaupt liebt Enzinger das Bunte und Grelle. Schon in den Akten zuvor führt er die einstige Wiener Gesellschaft (wenigstens, was er dafür hält) gewissermaßen vor, lässt sie von Makart porträtieren, während Freud in diesem skurrilen Jugendstilambiente seine Beobachtungen notiert, eine goldene Strauß-Figur stets im Hintergrund. Selbst eine kitschige Mozartfigur muss herhalten, um am Akkordeon den Karussellbesitzer Kagler bei seinen aktuell Politisches aufs Korn nehmenden Couplets - Musik aus der Strauß-Operette "Prinz Methusalem“, Texte von Volksopernchefdramaturg Christoph Wagner-Trenkwitz - zu begleiten. Aber muss sich Kagler (Wolfgang Böck) - was auch für Boris Eder als Kammerdiener des Grafen, erst recht für Gerhard Ernst als Fiakerkutscher gilt -- dabei einer so deftigen, die Grenzen des Ordinären streifenden Sprache bedienen? Zeichnet das den durch Wiener Blut strömenden Wiener Charme aus?
Auch die hysterischen Gebärden der Tänzerin Cagliari (Sieglinde Feldhofer) und der Probiermamsell Pepi (Reneé Schüttengruber) wirken auf die Dauer ermüdend, zumal dies meist nur von durchschnittlichen Gesangsleistungen begleitet wird. Dass sich Eigenheiten differenzierter zeichnen lassen, demonstriert Carlo Hartmann als köstlich steifer, das Wienerische so ganz und gar nicht verstehender Ypsheim, farblos, und dies auch vokal, dagegen Kristiane Kaiser als Zedlaus doch wieder für sich zurück gewinnen könnende Gattin Gabriele. Markschreierisch und pathetisch agierte Gernot Kranner als Ausrufer.
Genuin wienerisches Dirigat
Begabt mit einer kraftvollen Stimme, die er auch entsprechend einsetzt, stellte sich bei dieser Saisoneröffnungspremiere am Währinger Gürtel der belgische Tenor Thomas Blondelle als für Wien neuer Zedlau vor. Ob er schon in einer seiner nächsten Rollen zeigen wird, dass er auch über subtilere Töne verfügt?
Thomas Böttcher zeichnete für die Choreinstudierung verantwortlich, Bohdana Szivacz für die mit viel Schwung realisierte Choreografie. Was "Wiener Blut“ wirklich bedeutet, tönte vorrangig aus dem Orchestergraben, den mit Alfred Eschwé einer der immer seltener werdenden Dirigenten, die sich auf das genuin Wienerische verstehen, souverän befehligte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!






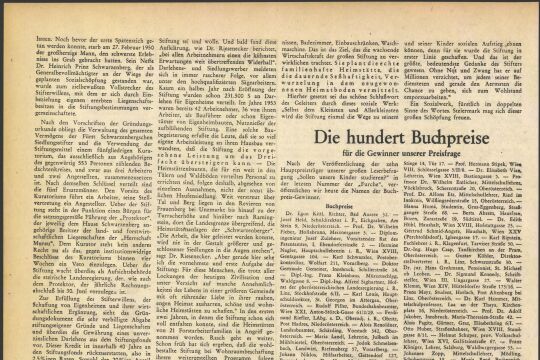































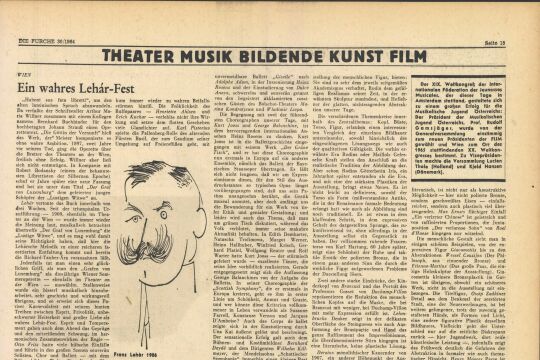






















































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)


