Die Meisterschaft der Operette 'Gasparone' liegt darin, aufzuzeigen, dass man Ernsthaftes hinter einer Folge bunter Aktionen verbergen kann. Darauf hätte sich die Inszenierung konzentrieren sollen.
Dunkelrote Rosen" ist der populärste Ohrwurm aus "Gasparone". Er findet sich aber nicht in der Erstverfassung, sondern in einer späteren Bearbeitung dieser am 26. Jänner 1884 am Theater an der Wien uraufgeführten Operette von Carl Millöcker. Nicht nur deswegen haben sich Regisseur Olivier Tambosi und Dirigent Andreas Schüller für diese spätere "Gasparone"-Version für ihre Produktion an der Volksoper entschieden. Ihnen erscheint diese dramaturgisch schlüssiger. Außerdem spiegelt sie den Zeitgeist der 1920er-Jahre wider. Und der, sind sich beide einig, sei dem der Gegenwart ziemlich ähnlich.
Ob bedacht wurde, dass diese von Ernst Steffan und Paul Knepler für das Berliner Theater an Nollendorfplatz erstellte, dort 1931 aus der Taufe gehobene Fassung nach großen Stimmen verlangt, wie sie damals mit Richard Tauber, Michael Bohnen, Margret Pfahl oder Leo Slezak zur Verfügung standen? Das kann man durch eine noch so ausgeklügelte Regie oder ein noch so raffiniertes Bühnenbild nie ganz vergessen machen.
Zwar lassen sich auf einer mit betont wenig Requisiten auskommenden Bühne (Andreas Wilkens) Personen besonders gut führen und zeichnen. Darin liegt auch Tambosis Ehrgeiz, selbst wenn er die Turbulenz des Geschehens und sein Faible, so manches in die Gegenwart zu transferieren, etwas übertreibt - wie dem Bürgermeister Baboleno Nasoni zuweilen Züge des gerade aus dem Amt geschiedenen Wiener Bürgermeisters Häupl zu verleihen. Das garantiert kurze, zum Schmunzeln einladende Pointen. Noch dazu, wenn der in dieser Rolle eines korrupten italienischen Bürgermeisters agierende, stimmlich unterschiedlich beeindruckende Gerhard Ernst die übrigen Darsteller dominiert. Für das Geschehen, gar den Plot der Geschichte bringen solche Details nichts.
Bloß eine niveaulose Bettgeschichte?
Mara Mastalir wiederum weiß als Gräfin Carlotta mit eleganter Gestik zu beeindrucken, lässt aber einiges an vokalem Glanz vermissen. Weshalb man für die Rolle des sich schließlich als Minister outenden Fremden Sebastian Geyer engagiert hat, erschließt sich nach seiner in jeder Hinsicht zögerlichen, eigenpersönliche Statur wie Charme vermissender Darstellung nicht. War es Nervosität, die ihn so unentschieden agieren ließ? Steckt wesentlich mehr in ihm, als er an diesem Premierenabend zeigte?
Auch die übrigen Protagonisten, wie David Sitka als ausschließlich an Sex-Abenteuern interessierter Bürgermeistersohn Sindulfo oder Johanna Arrouas als hyperaktiv um die Leidenschaft ihres Mannes Benozzo (mäßig Marco Di Sapia) buhlende Gattin Sora, kamen über solide Leistungen nicht hinaus. Ebenso enttäuschend das von Andreas Schüller mit kaum Feingefühl für die Feinheiten dieser Millöcker-Partitur befehligte, mit unterschiedlicher Präzision aufwartende Orchester und die in verschiedenerlei bunten Kostümen auftretenden, choreographisch (Stephan Brauer) wenig fantasievoll geführten Choristen.
Dabei war es erklärte Absicht des Leading Teams, mit dieser Produktion wirklich gute, mehr noch: mitreißende Unterhaltung zu bieten. Aber nicht immer geht auf, was man sich vorgenommen hat. Hat man sich die Latte zu hoch gelegt? Hätte die Regie auf den einen oder anderen Gag -wie Luigi (deftig Christian Graf) als "waschechten Wiener" aufzubieten oder mit dem Bühnenbild am Beginn zu suggerieren, dieses Stück sei bloß eine niveaulose Bettgeschichte -verzichten sollen, um das eigentliche Thema dieses Werks mit der nötigen Kontur herauszustellen: die ewig junge Korruption. Denn darin liegt die besondere Meisterschaft dieses Werks: aufzuzeigen, dass man Ernsthaftes hinter einer Folge bunter Aktionen verbergen kann, ohne damit die Botschaft auch nur im Mindesten zu verwässern. Darauf hätte sich die Inszenierung konzentrieren sollen, und nicht auf den mehr zu lesenden als auf der Bühne zu sehenden Versuch, dem Beschauer vor Augen zu führen, dass die Narrheiten der Gegenwart schon ein Jahrhundert davor gang und gäbe waren.
Ob die Volksoper mit ihren kommenden Premiere-Vorhaben mehr Fortüne haben wird? Zu wünschen ist es, denn im Dezember feiert das Haus am Währinger Gürtel sein 120-jähriges Bestehen. Eröffnet wird mit Emmerich Kálmáns Welterfolg "Die Czárdásfürstin". Erstmals auf dem Volksopernprogramm steht Ralph Benatzkys Operetten-Revue "Meine Schwester und ich". Die Opern-Neuinszenierungen gelten Lortzings "Zar und Zimmermann" und Wagners zuletzt 1908 an der Volksoper aufgeführtem "Fliegenden Holländer". George Gershwins "Porgy and Bess" wird konzertant geboten. Dem diesjährigen Bernstein-Jahr leistet man mit "Wonderful Town", das 1956 seine europäische Erstaufführung an der Volksoper erlebte, Tribut. Für das Kasino am Schwarzenbergplatz ist Thomas Adés' Opernerstling "Powder Her Face" avisiert.
Gasparone Volksoper, 10., 13., 15., 23., 26. Juni
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!













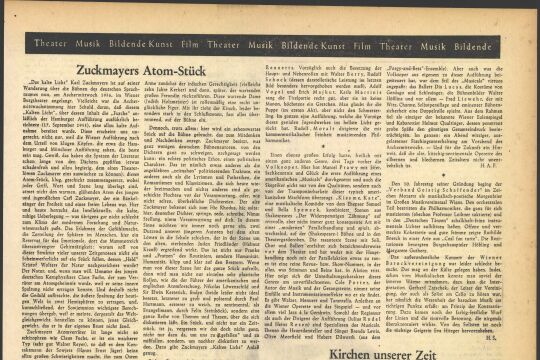




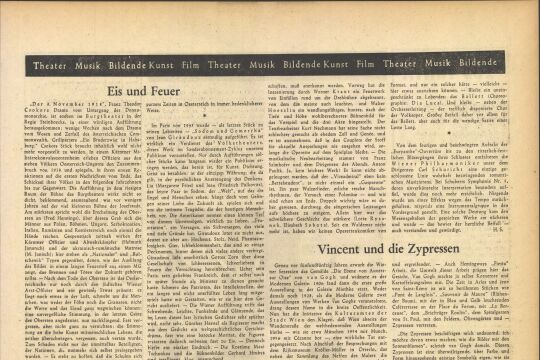



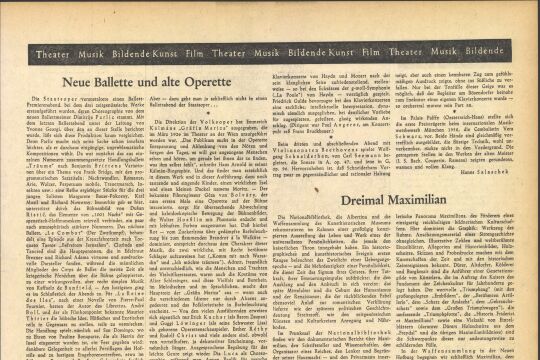



















































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)




_RET.jpg)













_edit.jpg)




