Es müssen nicht immer große Namen sein, die einen Erfolg garantieren. Das beweist die Wiener Volksoper mit ihrer neuen "Salome“, bei der auch eine vorzügliche Gestalterin der Titelpartie zu entdecken ist: die niederländische Sopranistin Annemarie Kremer, die ein insgesamt sehr erfreuliches, von Pult und Regie gut geleitetes Ensemble anführt.
Für Cosima Wagner war diese Richard-Strauss-Oper "ein Wahnsinn“, für den Vater des Komponisten eine "nervöse Musik“, für den Komponisten, als sie sein berühmter Kollege Arturo Toscanini an der Mailänder Scala dirigierte, eine "Symphonie ohne Sänger“, zudem mit "erbarmungslos wütendem Orchester“. Die Rede ist von dem 1905 in Dresden uraufgeführten Einakter "Salome“. Das Publikum war von diesem "Scherzo mit tödlichem Ausgang“, wie Strauss selbst seine Oper nicht ohne beißende Ironie bezeichnete, begeistert, ganz im Gegensatz zur Mehrzahl der Kritiken. Den Welterfolg konnte das nicht aufhalten.
"Perverse Sinnlichkeit“
An der Wiener Hofoper wollte Mahler das Stück seines wie auch er dirigierenden Komponistenkollegen bald nachspielen, hatte die Rechnung aber ohne die Zensur gemacht. "Sittlich verletzend“ und "Vorführung einer perversen Sinnlichkeit“ lautete ihr vernichtendes Urteil. Es dauerte bis 1918, ehe "Salome“ an die Staatsoper kam.
Da hatte die Volksoper die Nase längst vorne. Bereits 1907 konnte sie diese Strauss-Oper erstmals ihrem Publikum im Rahmen eines Gastspiels der Breslauer Oper vorstellen, drei Jahre später kam es zur ersten Eigenproduktion. Weil aller guten Dinge drei sind, debütierte im Jahr darauf, 1911, der Komponist mit diesem Werk als Dirigent im Haus am Währinger Gürtel, das "Salome“ seit dem Wochenende zeigt.
Auf einem Niveau, das sich so manches erste Haus zum Vorbild nehmen könnte - selbst wenn man sich zuweilen eine vor allem dynamisch differenziertere Darstellung des Orchesterparts hätte vorstellen können. Aber Dirigent Roland Böer, einem früheren Assistenten des Musikchefs des Royal Opera House Covent Garden, Antonio Pappano, ging es weniger um subtile Detailbeleuchtung, denn um eine plakative Herausarbeitung der Spannungskurven, was ihm auch gelang. Unverständlich, dass er dafür, wenn auch nur vereinzelt, Buhrufe einstecken musste.
Ein Schicksal, dass er mit dem Regieteam teilte. Dabei erzählt die in Wien und Paris ausgebildete Li- teratur- und Musikwissenschafterin Marguerite Borie, die zu Karrierebeginn Harry Kupfer, Willy Decker, Peter Konwitschny, Peter Stein oder Klaus-Michael Grüber assistierte und auf erfolgreiche eigene Regiearbeiten u. a. in Berlin und Belgien zurückblicken kann, die Geschichte mit einer nicht alltäglich zu erlebenden Selbst- verständlichkeit, wartet mit klaren Personenprofilen auf und ließ sich von Laurent Castaingt, der auch für die raffinierten Lichteffekte verantwortlich zeichnete, die passende, mit wenigen Mitteln auskommende Bühnenarchitektur entwerfen.
Begonnen wird hinter einem Vorhang, im Mittelpunkt ein den Eingang der Zisterne symbolisierender Kreis, der Hintergrund blau, auf einem Medaillon eingeblendet die sich lasziv gebende Salome. Später wird diese Szenerie noch durch einen hinter dem Zisterneneingang platzierten Turm ergänzt, der sämtliche Schauplätze ideal suggeriert. Ein Blickfang für sich die Finalszene: Nachdem sie den Kopf Jochanaans geküsst hat, entledigt sich Salome ihrer Kleider, geht in die Zisterne, die ihr Tor weit öffnet, inmitten den Mond spiegelnd. Ein Hinweis darauf, dass der Mond schon in Oscar Wildes "Salome“, welche die Grundlage der Strauss-Oper bildet, zentrale Bedeutung hat: als mit der heidnischen Göttin Kybele in Verbindung gebrachtes Symbol der sexuell pervertierten, auf die Kastration des Mannes konzentrierten Frau.
Kaum Wünsche offen
Packend, wie Annemarie Kremer nicht nur diese Szene gestaltet, sondern den Abend über die anspruchsvollen gestischen wie vokalen Anforderungen der Titelpartie erfüllt. Noch dazu in einer Umgebung, die kaum Wünsche offenlässt. Denn Wolfgang Ablinger-Sperrhacke gab einen wortdeutlich deklamierenden, schließlich seine Machtlosigkeit einbekennenden Herodes, Irmgard Vils- maier eine bewusst im Hintergrund bleibende Herodias. Jörg Schneider war ein souveräner Narraboth, Sebastian Holecek ein untadeliger Jochanaan, Martina Mikelic ein vorzüglicher Page. Ideal fügten sich in dieses Ensemble die Darsteller der Juden, der Nazarener, der beiden Soldaten und der von Yasushi Hirano verkörperte Cappadocier.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!



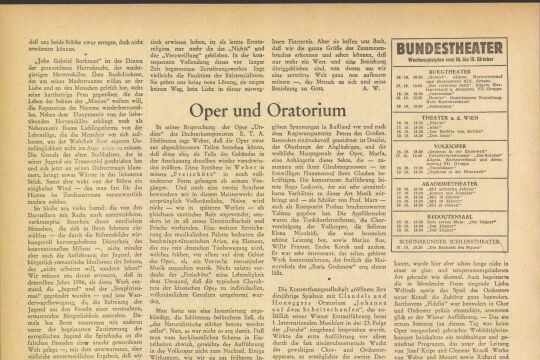













































































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)











_edit.jpg)



