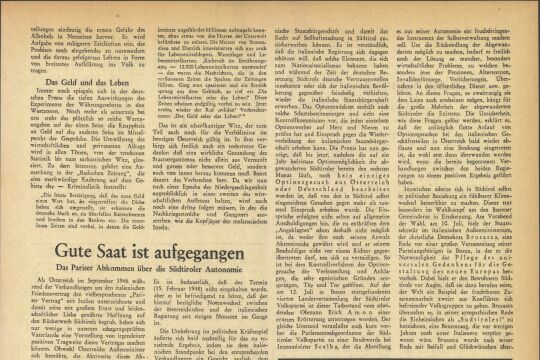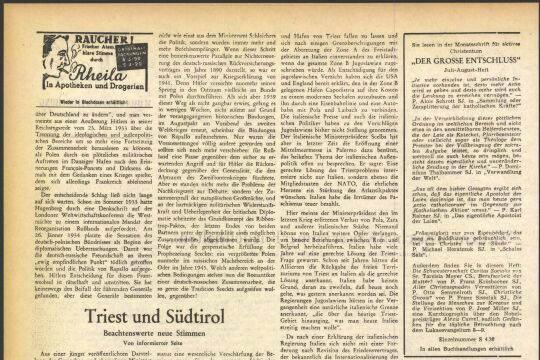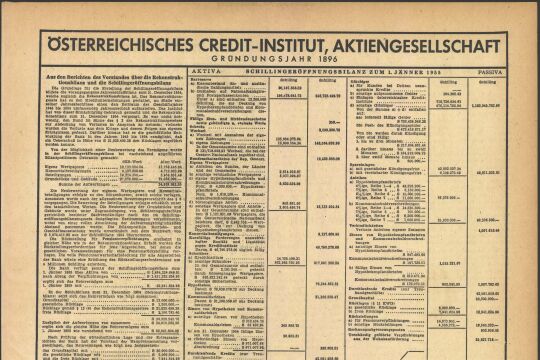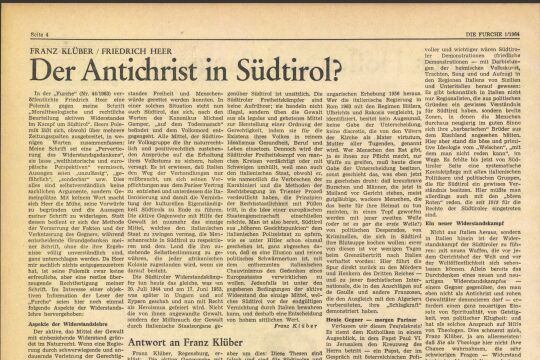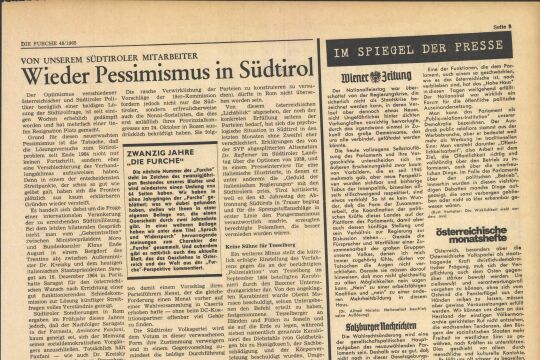Mit Dutzenden Sprengstoffanschlägen machten 1961 einige Südtiroler die Welt aufmerksam auf die Lage ihres Landes in Italien: Sie wurden italianisiert statt geschützt.
Schenna, 12. Juni 1961, 1.00 Uhr früh: Sepp Innerhofer wartet. Zwei Strommasten in Sinich sind "geladen“. Jetzt will er die Explosionen mit eigenen Augen sehen. Mit dem Fernglas im Anschlag hat er sich einen guten Aussichtspunkt gesucht und überblickt das Tal. Er wird nicht enttäuscht werden. Minuten später rollt eine Detonationswelle durch Südtirol. Der "Befreiungsausschuss Südtirol“, kurz BAS, hat zu seinem großen Schlag ausgeholt.
"Wir haben genug Schläge von den Italienern eingesteckt. Irgendwann schlägt man zurück“, sagt Sepp Innerhofer heute. Der Achtzigjährige erklärt, wie es zu den Anschlägen kam, die das Interesse der Weltöffentlichkeit auf das kleine Land Südtirol lenkten.
Italianisierung und "Todesmarsch“
Er erzählt von der enttäuschten Hoffnung der Südtiroler, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zu Österreich zu kommen; von den Schutzbestimmungen für die Südtiroler im Pariser Abkommen, die von Italien zwar unterschrieben, aber nicht umgesetzt worden seien. Die Italianisierungpolitik sei auch nach dem Krieg weitergegangen, nur mit anderen Mitteln. "Vom Todesmarsch der Südtiroler“ ist in den fünfziger Jahren in einem Zeitungskommentar zu lesen. Es gibt Menschen in Südtirol, die das Gefühl hatten, sich wehren zu müssen.
Der "Befreiungsausschuss Südtirol (BAS)“ wird gegründet, Sepp Innerhofer ist das letzte lebende Gründungsmitglied. Der Name ist Programm: Ziel ist die Rückgliederung Südtirols an Österreich. Anfangs sind die Mittel moderat: Flugblätter werden verfasst, Briefe geschrieben, Reden gehalten.
Sigmundskron 1957: 30.000 Menschen demonstrieren gegen die italienische Herrschaft in Südtirol. Umberto Gandini, italienischer Journalist, erinnert sich noch an die aufgeheizte Atmosphäre unter den Südtirolern. Doch die Demonstration ändert nichts; viele Menschen fühlen sich ohnmächtig - einer feindseligen Staatsmacht schutzlos ausgeliefert.
1961 dann die ersten Attentate auf faschistische Denkmäler. Den "Aluminium-Duce“ in Waidbruck "hat’s in tausend Fetzen zerrissen“. Das freut das Nordtiroler BAS-Mitglied Heinrich Klier noch heute. Die Scherben des Mussolini-Abbildes werden als Andenken gesammelt. "Dem Kreisky haben wir auch eine geschickt“, schmunzelt Sepp Innerhofer. Der damalige Außenmister Kreisky ist durchaus über die Aktivitäten in Südtirol informiert. Wenige Wochen zuvor hat er eine Delegation des BAS in seiner Wiener Wohnung empfangen. Da plant der BAS bereits den großen Schlag: In einer einzigen Nacht soll die Stromversorgung der oberitalienischen Industrie gekappt werden. Wenn die Hochöfen erlöschen, wäre der finanzielle Schaden riesig. "Das oberste Gebot war aber, keine Menschenleben zu gefährden“, sagt einer der Attentäter von damals.
Ein annektiertes Land
Die BAS-Männer, allen voran ihr Anführer Sepp Kerschbaumer, hegen keinen Hass gegen ihre italienischen Mitbürger. Sie kämpfen gegen ein System, von dem sie glauben, in ihm als Volksgruppe untergehen zu müssen. Umberto Gandini, damals junger Journalist, analysiert: "Es war die typische Politik einer kolonialen Macht, würde man heute sagen. Wir waren eine Besatzungsmacht in einem Land, das aus nationalistischen und auch defensiven Zwecken annektiert worden war.“
In ihrem Kampf werden die Südtiroler von ihren Nordtiroler Kameraden unterstützt. An jenem Juni-Wochenende, das in die Tiroler Geschichte eingehen wird, fahren 30 BAS-Aktivisten mit einem Reisebus nach Verona. Die Tarnung als Kunstreise ist perfekt. Das eigentliche Ziel ist Südtirol: "Die Österreicher haben im Raum Bozen geholfen. Dort ist am meisten passiert, denn der Zweck war ja, die Industriezone lahmzulegen“, schildert Sepp Mitterhofer.
Die Polizei bekam Angst
Doch so weit kommt es nicht: Aus technischen Gründen explodieren manche Sprengladungen nicht. Trotzdem bricht in einigen Gebieten Südtirols die Stromversorgung zusammen. Der Südtiroler Journalist Hans Karl Peterlini fasst zusammen: "Es war so geplant, dass es dauernd irgendwo krachte. Drei, vier Stunden Donnergrollen in Südtirol. Polizei und Militär waren regelrecht eingeschüchtert. Die haben sich in die Kasernen zurückgezogen, weil sie nicht wussten, was los ist, und geglaubt haben, der Krieg bricht aus.“
Ein Unfall fordert das erste Todesopfer des Südtirolkonflikts: Der Straßenwärter Giovanni Postal stirbt bei dem Versuch, eine nicht explodierte Sprengladung zu entfernen. Es wird weitere Tote geben, auf beiden Seiten.
Mit Folter haben sie nicht gerechnet
Der Paukenschlag ist gelungen: Die Öffentlichkeit wird aufgerüttelt. Doch der Preis ist hoch: Mitte Juli 1961 rollt eine Verhaftungswelle durch das Land. In den Carabinieri-Kasernen werden die Attentäter grausam gefoltert. Sie sollen Namen nennen. Sepp Mitterhofer, einer der Gefolterten, kann jene schrecklichen Tage in den Händen der Carabinieri nicht vergessen: "Es ist unglaublich, was der Mensch aushält, es ist aber auch unglaublich, wie Menschen andere behandeln können“, sagt er heute.
Viele Südtiroler und ihre Familien haben die "Feuernacht“ schwer gebüßt, Hunderte wurden verhaftet, Dutzende wurden gefoltert und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt, einige starben. Nach der "Feuernacht“ glich Südtirol einem besetzten Kriegsgebiet. Folterungen wurden mit einer Radikalisierung des Kampfes beantwortet, eklatante gerichtliche Fehlurteile führten zu Verbitterung, Hass und internationaler Kritik. Schauprozesse gegen Südtirol-Aktivisten machten eine breite - auch italienische - Öffentlichkeit mit dem Problem in der kleinen nördlichen Bergprovinz erstmals vertraut. Das offizielle Österreich reagierte doppelbödig, ermunterte die Südtiroler unverhohlen, unterstützte sie heimlich, reagierte auf internationalen Druck, distanzierte sich, ließ Mittäter verhaften und in Prozessen von Geschworenen freisprechen.
Österreichs Außenminister - von Bruno Kreisky bis Kurt Waldheim - verhandelten schließlich einen tragfähigen Kompromiss, das sogenannte Paket. Vieles in Südtirol hat sich in den letzten vierzig Jahren zum Guten gewendet, darüber besteht auch unter den ehemaligen Attentätern kein Zweifel. Manche haben sich mit der politischen Lage in ihrer Heimat abgefunden, anderen ist die - in Europa als Musterautonomie geltende - Regelung nicht genug.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!