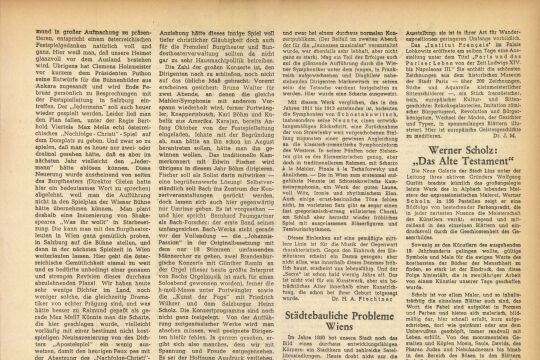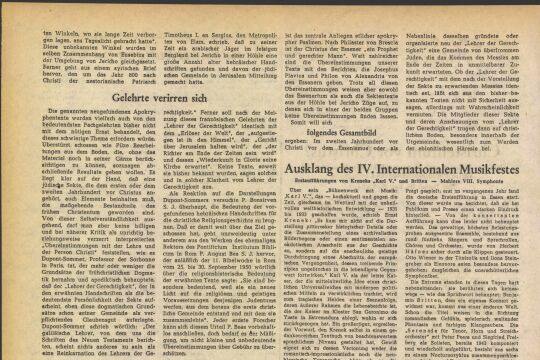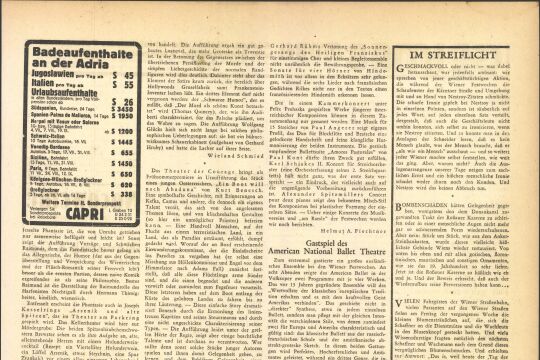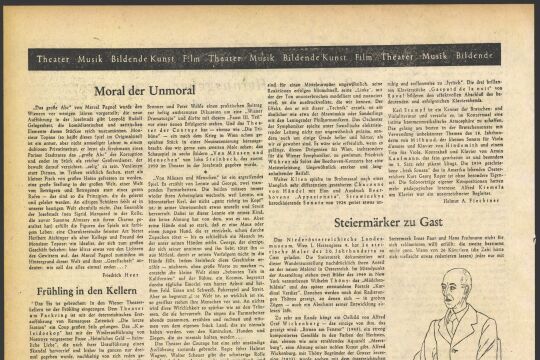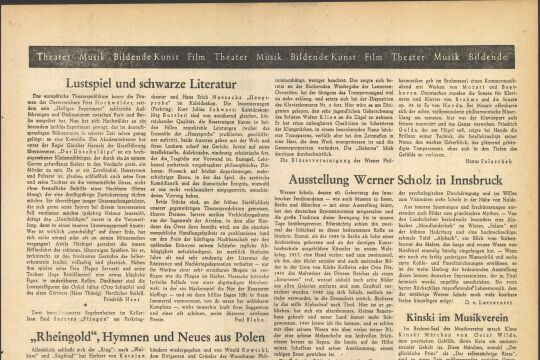Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der „Formalist“ und die „Revolutionäre“
Seit 1925 suchte Strawinsky einen Opern-Itoff. Schon viel früher erwog er die Zusammenarbeit mit dem in seiner Nähe lebenden Jean Cocteau. Es sollte ein klassisches Sujet sein, und die Wahl fiel auf „König Oedipus“ von Sophokles. Cocteaus raffiniert-einfacher Text, der wie ein Extrakt aus der klassischen Tragödie wirkt, wurde von Jean Danielou ins Lateinische übertragen. Hiefür waren weniger praktische Erwägungen (man brauchte keine Uebersetzungen für Aufführungen in anderen Ländern) maßgebend, als der Wunsch, „ein Medium zu haben, das nicht .tot, sondern versteinert wäre und durch seine Monumentalität über alles Vulgäre erhaben“. Gleichzeitig bot sich die Möglichkeit, allen Lyrismen, allem Sentimentalen und Allzuindividuellen auszuweichen, indem man den Text nur als phonetisch-metrisches Material benutzt. „Ist dies nicht“, so fragt Strawinsky in seiner Selbstdarstellung, „die Art und Weise, wie die alten Meister des strengen Stiles den Text behandelten?“ — Dem strengen Stil der Musik sollte auch die Inszenierung entsprechen. Ein in drei Reihen aufgestellter Chor, von dem man nur, über einem Basrelief, die Köpfe sieht, die Protagonisten wie lebende Statuen in hieratischen Kostümen und Masken, nur Arme und Köpfe bewegend, Oedipus am Ende des zweiten Aktes durch eine Falltür verschwindend und mit einer neuen Maske als Geblendeter wiederauftauchend: dies alles sollte den monumentalen und statischen Charakter des Werkes betonen. Dazu, gewissermaßen als Verfremdungseffekt, ein Sprecher im Frack, der die Handlung erläutert.
Szenische Aufführungen des Opernoratoriums „Oedipus Rex“ waren selten. Unmittelbar nach der Berliner Premiere unter Otto Klemperer folgte die Wiener Staatsoper (1928). Dann verschwand bei uns das bedeutsame Werk für lange Zeit und wurde erst beim IV. Internationalen Musikfest vor anderthalb Jahren wiederentdeckt. Nun folgte der Musikverein mit einer ganz ausgezeichneten Aufführung unter Karajan mit dem Männerchor des Singvereins, den Symphonikern und den Solisten E. Haefliger (Oedipus), H. Rehfuß (Kreon), F. Guthrie (Teiresias und Bote), M. Dickie (Hirte), Heinz 'Woester als Sprecher und Magda Laszlo als Jokaste und einzige Frau in dem Männerensemble. Der Eindruck war stark. Der lebhaft einsetzende Beifall wurde abgestoppt. (Hierüber einmal später an anderer Stelle.)
Konzertant war auch die Uraufführung des Werkes unter der Leitung des Komponisten 1927 im „Theitre Sarah-Bernhardt“ in Paris. Im Jahr darauf wurde „Oedipus Rex“ durch den Chor der Leningrader Staatsakademie unter Klimow aufgeführt. Heute ist Strawinsky dort nicht nur als Emigrant, sondern auch als „Formalist“ verpönt. Sein Intellektualismus, seine Neigung zum Stilisieren, insbesondere zum Archaisieren, die Vorherrschaft des rhythmischen Elements auf Kosten des melodischen, seine harmonischen Härten und die hämmernden Ostinati: das alles widerspricht entschieden dem „realistisch-humanistischen“ Kunstideal, das im Vaterland Strawinskys und der Revolution aufgerichtet wurde. Damals freilich, in den zwanziger Jahren, las man es anders. Da wurde die neue „revolutionäre“ Kunst, etwa bei den „Abenden für neue westliche Musik“ in Leningrad und in der „Assoziation für zeitgenössische Musik“ eifrig gepflegt. Damals spielte die Leningrader Philharmonie Werke von Schönberg, Krenek, Milhaud, Hinde-mith und — immer wieder — Strawinsky. Im großen Operntheater konnte man Schrekers „Fernen Klang“, Bergs „Wozzeck“ und Kreneks „Jonny“ hören... Tempi passati, über die man in der Schostakowitsch-Biographie von J. Martynow (Leningrad 1946, deutsche Ausgabe von 1947) interessante Details nachlesen kann.
Betrachtet man die heutigen Programme s o-w jetischer Künstler, so möchte man fast von einer Gegenrevolution sprechen. In einem Gastkonzert in der Akademie hörten ten wir einen virtuosen Geiger (M. Weimann) und einen großartigen Natursopran (N. Massleni-kowa), von einer ganz vorzüglichen Pianistin begleitet. Man spielte die Cesar-Franck-Sonate und Paganini, ein Scherzo von Tschaikowskij und eine „Moldauische Rhapsodie“, man sang sehr lyrisch und intim Brahms und sehr effektvoll-theatralisch „Gretchen am Spinnrad“, Lieder von Rachmani-now und die große Arie der Tosca: Programme also, die sich in nichts von den unsern unterscheiden, die höchsters noch einen stärkeren Zuj; zum Gefällig-Konventionellen zeigen. Diesen Eindruck bestätigte auch der Klavierabend von Pawel Serebrjakow, der Beethoven für einen hochromantischen Komponisten hält und sich erst bei Liszts „Valse oubliee“ und Rachmaninows „Elegie“ richtig zu Hause fühlt. Zu Hause, also nicht mehr auf den Barrikaden der Kunstrevolution, sondern im großbürgerlichen Salon.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!