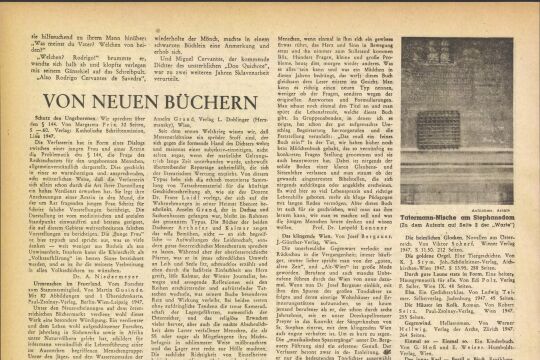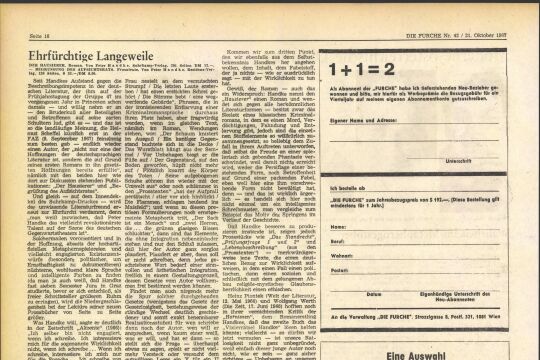"Das Adressbuch" von Sophie Calle: Fährten und Finten
Die französische Künstlerin Sophie Calle spielt mit der Inszenierung von Tabubrüchen, so auch in ihrem Buch „Das Adressbuch“, einer metaphorischen Collage.
Die französische Künstlerin Sophie Calle spielt mit der Inszenierung von Tabubrüchen, so auch in ihrem Buch „Das Adressbuch“, einer metaphorischen Collage.
Das Adressbuch ist ein bewährter, kostbarer Datenspeicher. Alphabetisch listet es Namen, Adressen und Telefonnummern auf, dazu allfällige Mail-Adressen oder Social-Media-Accounts. Regelmäßig greifen wir auf die Einträge zu, spezielle Anlässe erhöhen die Frequenz. Und in Zeiten von Krisen, die ganze Gesellschaften erfassen, wo „soziale Distanz“ zur obersten Räson des Miteinanders wird, erfüllt das Adressbuch eine ganz besondere Funktion. Es hält ein virtuelles Tor zur Außenwelt offen. Plötzlich durchsuchen wir es nach all den Menschen, denen wir einmal so viel Bedeutung beimaßen, dass sie „gelistet“ wurden. Wir fragen nach ihrem Befinden und fassen den lauteren, vielleicht nicht ganz selbstlosen Vorsatz, die Verbindung zu halten.
Wer ist Pierre D.?
Ein solcher Datenschatz ist von großem Nutzen, aber auch von erheblicher Aussagekraft, lässt er doch Rückschlüsse auf den Besitzer zu. Welch Nachwehen sein Verlust haben kann, zeigt der folgende Fall: Es begab sich im Paris des Jahres 1983. In der Rue des Martyrs ging ein Adressbuch verloren. Der Zufall spielte es der damals 30-jährigen Sophie Calle in die Hände. Einer Pariser Konzeptkünstlerin, die auch schon als Barfrau, Stripperin oder Globetrotterin durchs Leben getingelt war, ehe sie mit ihren Installationen, Aktionen und Foto-Text-Collagen für Aufsehen sorgte. 1979 verfolgte sie (gleichsam in Detektiv-Kostümierung) Passanten, fotografierte sie und stellte die kommentierten Bilder aus.
1984 jobbte sie als Zimmermädchen in einem Venezianischen Hotel und spionierte fotografisch die Sachen der Gäste aus („L’Hôtel“, Bildband mit journalartigen Begleittexten). Calle ließ sich auch selbst von einem Detektiv verfolgen (Projekt mit dem sprechenden Titel „Der Schatten“) oder den Trennungsbrief ihres Geliebten von hundert Frauen vorlesen. Und als ihre Mutter im Sterben lag, filmte sie – mit deren Einverständnis – die letzten Stunden mit.
Calle las also besagtes Adressbuch auf und retournierte es anonym an den Besitzer, „dessen Kontaktdaten auf der ersten Seite stehen“ (wer macht denn so was?). Zuvor hatte sie alle Seiten kopiert, um den Fund für eine Kolumne auszubeuten. Die Beiträge erschienen im Spätsommer 1983 in der Tageszeitung Libération. Nun liegen die 28 Kolumnen auf Deutsch vor, unter dem Titel „Das Adressbuch“ und illustriert mit S/W-Fotografien der Künstlerin. Sabine Erbrich besorgte die Übersetzung, Sophie Calle steuerte das Vor- und Nachwort bei: „Ich wollte die darin verzeichneten Kontakte anrufen und sie bitten, mir den Besitzer des Adressbuchs zu beschreiben. Ziel des Ganzen war es, diesen Mann kennenzulernen, ohne ihn je zu treffen. Und ein Porträt von ihm anzufertigen, abhängig von den Erzählungen seiner Kontakte. Und vom Zufall.“
Calle nennt den Mann „Pierre D.“ In Telefongesprächen und persönlichen Treffen befragte sie seine Kontakte, die bereitwillig, ja nahezu arglos Rede und Antwort standen. Nur zwei wiesen Calles Ansinnen zurück. Wer ist also dieser Pierre D.? Ein Mann der Filmbranche, ein Dozent, Kritiker und Drehbuchautor, so viel scheint bald klar; auch, dass er gerade verreist ist. Die Antworten haben den Anstrich von Gesprächsprotokollen, deren Authentizität allerdings fraglich scheint. Schon der Duktus mancher Befragter irritiert. Jacques O. etwa skizziert Pierre D. folgendermaßen: „Eine ganz und gar eigenartige Sprechmelodie. Die mit seinem, wie ich ihn nennen würde, komischen Charakter zusammenhängt. Eine Art bewusst gepflegte Unstimmigkeit, an der Grenze zum Manierismus ...“
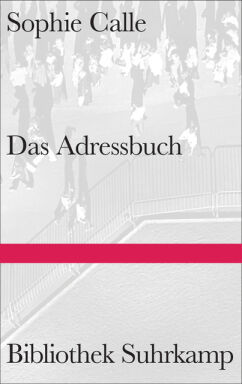
Das Adressbuch
von Sophie Calle
Aus dem Französischen
von Sabine Erbrich
Suhrkamp 2019
112 S., geb., € 22,70
Argwöhnisch machen auch die biografischen Splitter. Sie erinnern oft frappant an diverse Größen der Filmavantgarde, vornehmlich der Nouvelle Vague. Und Calles verdecktes wie offenes Spiel mit literarischen Referenzen nährt generelle Zweifel an der Verbürgtheit der Geschichte: Pierre D.s Begegnung mit der Filmstudentin Florence B. gerät zur Cinderella-Szene, dann wieder taucht eine Großtante von Proust’schem Zuschnitt auf; Edgar P. Jacobs Comic-Helden Blake und Mortimer geistern durch die Zeilen, und ein Drehbuchprojekt von Pierre D. lässt an Georges Perecs Roman „Das Leben. Gebrauchsanweisung“ denken. Das Bauprinzip des Puzzles, die kryptischen Fotos und Texte sorgen obendrein für den Suspense-Effekt eines Detektivromans.
In Summe ergibt sich kein reales Porträt des Umkreisten, sondern das vage Profil eines bestimmten Typus: eines Verführers und brillanten Intellektuellen, dessen Ringen um Wahrheit so fruchtlos verläuft wie seine Suche nach Liebe. Calle nutzt das Adressbuch als Objet trouvé für eine metaphorische Collage, macht es zum Kunstobjekt. Sie kalkuliert mit dem Empörungspotenzial des Tabubruchs. Und tatsächlich provozierte ihr vorgeblicher Datenmissbrauch einen Skandal. Pierre D. fühlte sich in seiner Privatsphäre verletzt und holte unter seinem wahren Namen zum Gegenschlag aus – in der Libération. Er „versah seine Replik mit […] einer Nacktfotografie von mir, die er sich auf meine Art beschafft hatte“, erklärt Calle im Nachwort. In der Riposte des Betroffenen klingt das so: Er habe das Foto „vor einigen Tagen in der Rue des Martyrs“ gefunden, „gemacht wurde es von dem Fotografen Patrice B.“ Der zu Kunstzwecken Gestalkte erwirkte – für seine Lebzeiten – ein Publikationsverbot der Kolumnen.
Literarische Doppelspiele
Die ganze Aktion samt medial-juristischer Begleitmusik war wohl eine raffinierte Inszenierung. Kunst und Literatur erheben den Tabubruch zum ästhetischen Mittel, zum Programm. Und Sophie Calle ist eine Meisterin darin, die Grenzen der Konvention listig auszureizen. Ihr dokufiktionaler Voyeurismus verzahnt Bildkunst und Literatur zu Emblemen, die auf die brüchige Identität des modernen Subjekts verweisen. Das gilt auch für das „Adressbuch“: Wiederholt wird Pierre D. als Clown oder Schelm beschrieben, als tragikomische Figur in „zu großen Hemden“ oder „Wolke in Hosen“. Es sind Kleidermetaphern für einen Unbehausten, letztlich nicht Fassbaren: „Er ist hier bei dir, macht Witze. Und gleichzeitig weißt du nicht, wer er ist. Ohne fabulieren zu wollen, ist er jemand, der dazu fähig wäre, spurlos zu verschwinden.“
„Das Adressbuch“ ist ein ausgeklügeltes Verwirrspiel mit Fakten und Fiktion, das noch eine voltenreiche Fortsetzung fand. Denn ein ganz Großer dieser Kunst der Spiegelfechterei, Paul Auster, schrieb Sophie Calles Aktion in seinen Roman „Leviathan“ ein und schuf mit der Figur Maria ein Double der Künstlerin. Calle wiederum inspirierte sich an Austers Romanfigur – und imitierte diese in einem weiteren Kunstprojekt: „Doubles- Jeux“, Doppelspiel – ein treffender Titel für Calles gesamtes Schaffen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!