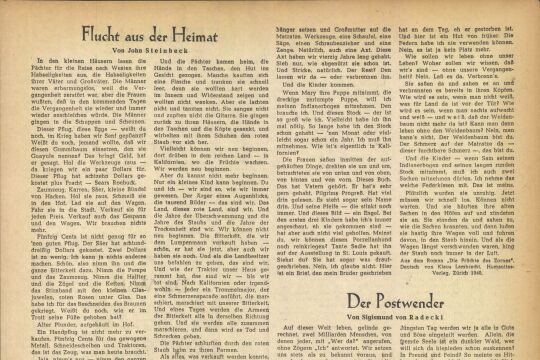Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Fax oder das Ende der Briefkultur
Oft fragen seine zahlreichen Leser Dietmar Grieser: Woher haben Sie all die biographischen Details? Hier gewährt der literarische Spurensucher Einblick in seine „Werkstatt“.
Oft fragen seine zahlreichen Leser Dietmar Grieser: Woher haben Sie all die biographischen Details? Hier gewährt der literarische Spurensucher Einblick in seine „Werkstatt“.
Zunächst war es nichts als eine strikt private Passion, sozusagen mein erstes Laster: die Gier nach Post. Noch in meinen frühen Schüler) ahren wuchs es sich zur Süchtigkeit aus: Der Briefträger als Heilsbote. Andere Buben meines Alters spielten Fußball, bauten im Garten hinterm Haus Fallgruben oder flochten Halsketten aus Begenwürmern. Hatten sie überhaupt eine Beziehung zur Post, so erschöpfte sich diese im Tauschen von Briefmarken.
Ich aber bekam Post.
Oder genauer gesagt: Ich legte es mit allen Mitteln darauf an, Post zu bekommen. Und je besser es funktionierte, desto süchtiger wurde ich.
Damals konnte man, wenn man es gar nicht mehr aushielt (überhaupt in der Kleinstadt, in der ich aufwuchs), noch dem Briefträger entgegenlaufen und ihn je nach dem Grad seiner Gutmütigkeit dazu überreden, schon etliche Häuserblocks vorm Ziel das betreffende Bündel aufzuschnüren und dem vor Ungeduld Vibrierenden das ihm Zubestimmte auszufolgen.
Da ich entsprechend vorgesorgt hatte, bekam ich so gut wie nie das leidige „Für dich ist heute nichts dabei, aber vielleicht morgen!“ zu hören: Für mich war immer etwas dabei. Aus Zeitungen und Illustrierten schnipselte ich immerzu die Prospektangebote heraus, Preisrätselkupons und Gutscheine für die obskursten Warenproben und wurde so mit meinen zehn Jahren zur Nummer eins unter den Postempfängern im weiten Umkreis.
Natürlich konnte ich mich auf die Dauer mit dieser Art von Pseudopost nicht zufriedengeben: „Bichtige“ Briefe waren das Ziel. Ihm nahezukommen, war schon um etliches schwieriger: Welcher meiner Freunde würde dafür zu gewinnen sein, mir in umständlichem Geschreibsel und mit aufwendiger Frankierung mitzuteilen, was er mir ebensogut auf dem gemeinsamen Schulweg oder im Pausenhof mündlich übermitteln konnte?
Hier also war ein mühevolles Stück Erziehungsarbeit zu leisten, in das ich auch alle meine Verwandten und Bekannten einbezog. Doch meine Zähigkeit trug Früchte: Bald trafen die ersten „richtigen“ Briefe ein. Später folgte die Phase der Liebesbriefe, noch später die der ersten „Geschäftspost“ (ich trieb eine Zeit lang einen schwunghaften Handel mit selbstverfertigten, nur im Abonnement beziehbaren Hauszeitungen), und heute — inzwischen ist beinahe ein halbes Jahrhundert verstrichen - steht die Sache auf festen Beinen: Ohne noch besonders nachhelfen zu müssen, erreicht mich in continuo Post aus der ganzen Welt, und es gibt Tage, wo sich der Briefträger dermaßen für mich abschleppt, daß ich ernstlich überlege, ob es nicht an der Zeit ist, über Schritte nachzudenken, meinen Posteingang einzudämmen.
BRIEFE ALS BESTE QUELLE
Dafür aber verlagerte sich meine Briefsüchtigkeit im Lauf der Zeit auf eine andere, eine qualitativ höhere Ebene: Briefsammlungen der von mir verehrten Dichter, in Sammelbänden herausgegeben, wurden zu meiner bevorzugten Lektüre — teils beim Buchhändler erworben, teils aus Büchereien entlehnt. Denn ich kam sehr bald dahinter, daß sie die bei weitem beste Quelle waren, „alles“ über das betreffende Idol zu erfahren, ergiebiger als jede noch so gründliche Biographie. Was anderen nebensächlich erscheinen mochte: All die intimen Details, die versteckten Anspielungen, die subtilen Werkstattgeheimnisse - hier lagen sie offen vor meinem begierigen Auge ausgebreitet, und als ich vor nunmehr zweiundzwanzig Jahren selber begann, Bücher zu schreiben, wußte ich von Stund an mit Vorteil aus diesem Fundus zu schöpfen:
Hermann Hesse und Rainer Maria Rilke, Theodor Fontane und August Strindberg, Arthur Schnitzler und Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein und Gottfried Benn - an ihren Briefen sollt ihr sip erkennen!
Immer wieder werde ich heute in Interviews oder auch von Lesern, die mir auf die Schliche zu kommen versuchen, gefragt: Wo haben Sie denn das alles bloß her? Und ich antworte wahrheitsgemäß: Aus ihren Briefen.
Als Christian Morgenstern seine spätere Frau, Margareta Gosebruch von Liechtenstein, kennenlemte, bildete die Korrespondenz mit ihr streckenweise seine einzige Tätigkeit; schon von der Todeskrankheit gezeichnet, schleppte er sich bis zu dreimal am Tag zum Briefkasten seines Wohnbezirks. Und Gustav Klimt brachte es in Zeiten des Getrenntseins von seiner Muse Emilie Flöge auf bis zu acht Postkarten pro Tag.
Ich weiß schon, es ist nicht alles Weltliteratur, was da, eilig auf einen Bogen Briefpapier hingekritzelt, auf die Reise geht. Aber auch scheinbare Banalitäten haben ihren Aussagewert. Sie vervollständigen das Bud, stellen Partikel einer imaginären Biographie dar, sind für den Spuren- Sucher kostbares Rohmaterial.
Umso größer sind die Ängste, die mich seit einiger Zeit in immer größerer Häufigkeit beschleichen: Was um Himmels willen wird später einmal sein, wenn es mit der allgemeinen Briefkultur, die schon jetzt in so dramatischem Verfall begriffen ist, ganz und gar vorbei sein wird? Günter Grass und Umberto Eco, Gabriel Garcia Marquez und John Up- dike - schreiben die denn überhaupt noch Briefe? Wird nicht auch bereits in den Dichterklausen nur mehr telefoniert und gefaxt? Vieles spricht dafür. Und das bedeutet: Die neuzeitlichen Kommunikationsmittel, so effizient ihre Benützung sein mag, drohen einen für die Nachwelt unschätzbaren Informationsquell zum Versiegen zu bringen: die Brieflitera- tur.
Als ich im Zuge der Recherchen für das Kokoschka-Kapitel meines Buches „In deinem Sinne“ bei Frau Olda in Villeneuve zu Gast war, hatte die Witwe des Meisters gerade die Korrekturen für den vierten Band der großen Briefedition in Arbeit. Es waren dramatische Momente, aus ihrem Mund zu erfahren, welche tiefen Einsichten, welche neuen Aufschlüsse und auch welche Berichtigungen gängiger Irrtümer sie der Durchsicht des brieflichen Nachlasses verdankte, und es war ihr das Glück darüber anzusehen, daß OK ein so penibel-fleißiger Briefschreiber gewesen ist: „Er hatte einen’ Horror vorm Telefonieren.“
Mittlerweile droht längst eine noch viel größere Gefahr: Das Faxen mit der ihm eigenen Tendenz zu äußerster Knappheit und nüchternster Lakonik ist der vielleicht entscheidende Schritt zum totalen Ende der Briefkultur. Alle, die mit Quellenforschung zu tun haben, werden es schon bald schmerzlich zu spüren bekommen, und eine Rettung ist nicht in Sicht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!