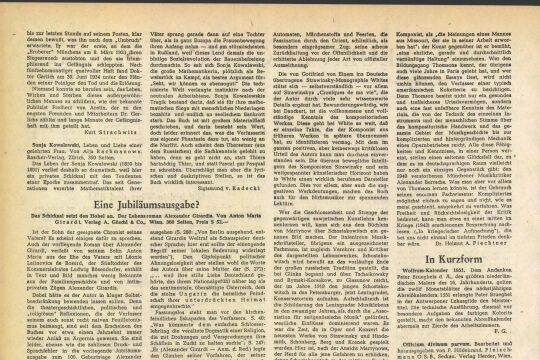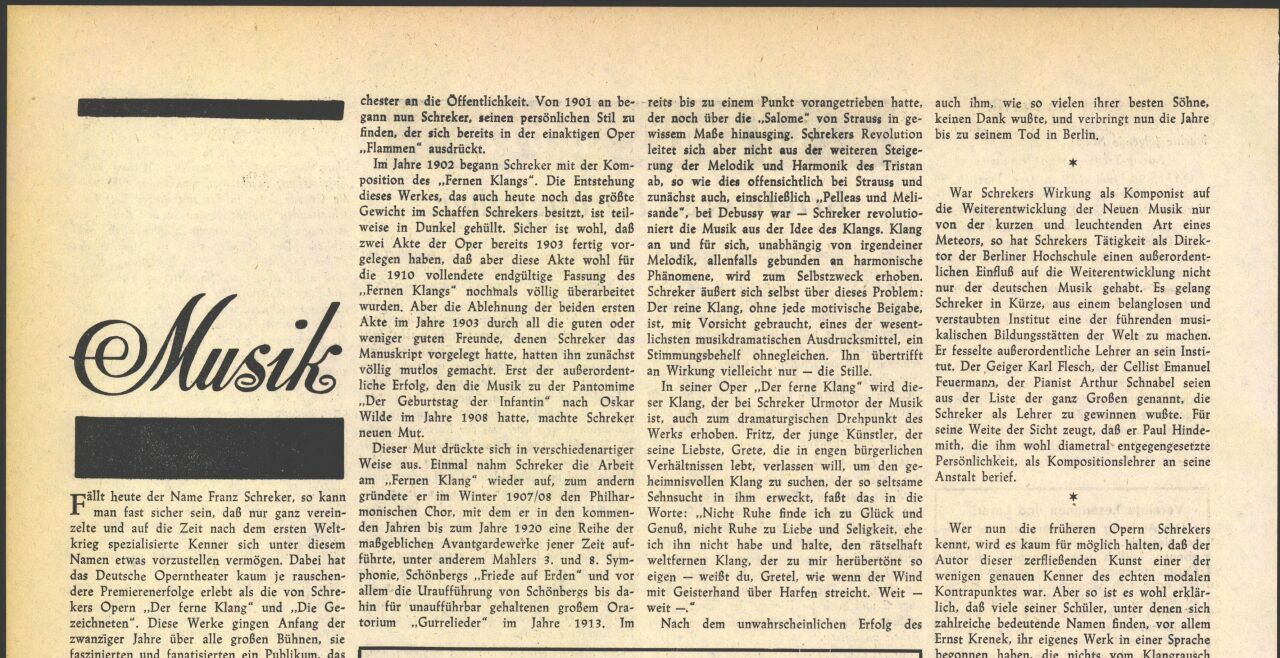
Fällt heute der Name Franz Schreker, so kann man fast sicher sein, daß nur ganz vereinzelte und auf die Zeit nach dem ersten Weltkrieg spezialisierte Kenner sich unter diesem Namen etwas vorzustellen vermögen. Dabei hat das Deutsche Operntheater kaum je Täuschendere Premierenerfolge erlebt als die von Schre-kers Opern „Der ferne Klang“ und „Die Gezeichneten“. Diese Werke gingen Anfang der zwanziger Jahre über alle großen Bühnen, sie faszinierten und fanatisierten ein Publikum, das Schreker wenige Jahre später völlig vergaß.
Schon aus dieser historischen Feststellung wird evident, daß mit Schrekers Werk eine Art von Tragik verbunden sein muß, die in solchem Maß eigentlich allen Komponisten, deren Schaffen sich von der Nachromantik löste und der Neuen Musik zustrebte, erspart blieb. Liest man heute die Hymnen, die Paul Bekker — in den zwanziger Jahren eine der führenden Stimmen der deutschen Musikkritik — über Schreker geschrieben hat und die etwa den Tenor haben: Wozu noch Wagner, wir haben ja Schreker, dessen Opern Wagners Werke so sehr überstrahlen, daß man diese ruhig vergessen kann — so ist es kaum glaublich, mit welcher Geringschätzung bereits Anfang der dreißiger Jahre die Kritik von Schreker sprach. Dabei zeigt sich heute, daß Schreker, der eine Zeitlang geradezu mit Schönberg Schritt gehalten hatte, in weit höherem Maße in Wegbereiter der Neuen Musik ist als viele seiner Zeitgenossen, deren Modernität man zu ihren Lebzeiten nicht hoch genug preisen konnte.
Franz Schreker wurde 1878, dank der Reiselust seines Vaters, des Wiener Hofphotographen Ignaz Schreker, in Monako geboren. Als Schreker zehn Jahre alt war, starb sein Vater. Nun kam die Not ins Haus. Zwar konnte der Knabe dem Musikstudium obliegen, aber er mußte auch hart arbeiten, um zum Unterhalt der Familie beizutragen. Aus dieser Not der Kindheitsjahre ist die Sehnsucht des Mannes zu verstehen: nach Pracht, nach Freude, nach Liebe. Die Vision seiner ersten Oper, des „Fernen Klangs“, wenn man von dem Jugend-Opernversuch „Flammen“ absieht, hat Schreker nie mehr verlassen, die Vision des armen Künstlers, der in die Welt zieht, einem fernen, geheimen Klang nachjagend, der diesen Klang, trotz Erfolges, trotz gewonnenen Reichtums nicht findet und ihn erst angesichts des tragischen Scheiterns des Lebens, der Liebe, schon vom Tode gezeichnet, in sich hört. Vielleicht ist es einer der Gründe für die Tragik Schrekers, daß er diesen Klang, diese Konstruktion seiner Vision wie eine fixe Idee mit sich trug und so im Grunde mit seinem ersten Werke eine so entscheidende Aussage tat, daß seine späteren Werke nur wie eine schwächere Rekapitulation der im „Fernen Klang“ angegangenen Probleme wirken mußten.
Nachdem der Vierzehnjährige eine Organistenstelle an der Döblinger Pfarrkirche antreten durfte und am Wiener Konservatorium eine durch ein Stipendium mögliche Freistelle erhalten hatte, gründete er in Döbling sogleich einen Orchesterverein, mit dem er sogar eigene Werke aufführte. Das war gegen die Statuten des Konservatoriums. Schreker sollte dimitiert werden, aber man war durch seine „Untat“ auf ihn aufmerksam geworden, erkannte seine Fähigkeiten und unterließ eine Strafaktion, ja im Gegenteil, Schreker wurde 1897 in die Kompositionsklasse des berühmten, strengen Kompositionslehrers Fuchs aufgenommen. Während seiner Konservatoriumszeit komponierte er den größten Teil seiner Lieder und drang mit dem langsamen Satz seiner a-moll-Symphonie und dem 116. Psalm für Frauenchor und Orchester an die Öffentlichkeit. Von 1901 an begann nun Schreker, seinen persönlichen Stil zu finden, der sich bereits in der einaktigen Oper „Flammen“ ausdrückt.
Im Jahre 1902 begann Schreker mit der Komposition des „Fernen Klangs“. Die Entstehung dieses Werkes, das auch heute noch das größte Gewicht im Schaffen Schrekers besitzt, ist teilweise in Dunkel gehüllt. Sicher ist wohl, daß zwei Akte der Oper bereits 1903 fertig vorgelegen haben, daß aber diese Akte wohl für die 1910 vollendete endgültige Fassung des „Fernen Klangs“ nochmals völlig überarbeitet wurden. Aber die Ablehnung der beiden ersten Akte im Jahre 1903 durch all die guten oder weniger guten Freunde, denen Schreker das Manuskript vorgelegt hatte, hatten ihn zunächst völlig mutlos gemacht. Erst der außerordentliche Erfolg, den die Musik zu der Pantomime „Der Geburtstag der Infantin“ nach Oskar Wilde im Jahre 1908 hatte, machte Schreker neuen Mut.
Dieser Mut drückte sich in verschiedenartiger Weise aus. Einmal nahm Schreker die Arbeit am „Fernen Klang“ wieder auf, zum andern gründete er im Winter 1907/08 den Philharmonischen Chor, mit dem er in den kommenden Jahren bis zum Jahre 1920 eine Reihe der maßgeblichen Avantgarde werke jener Zeit aufführte, unter anderem Mahlers 3. und 8. Symphonie, Schönbergs „Friede auf Erden“ und vor allem die Uraufführung von Schönbergs bis dahin für unaufführbar gehaltenen großem Oratorium „Gurrelieder“ im Jahre 1913. Im Jahre 1909 ging er an die Vollendung des „Fernen Klangs“, nachdem bereits ein Bruchstück dieser Partitur unter dem Titel „Nachtstück“ ihm bei einer Wiener Aufführung eindeutigen Erfolg gebracht hatte. Nun geschah auch das Wunder: Bruno Walthex ließ sich von Schrekers Partitur überzeugen, empfahl sie dem Direktor der Wiener Hofoper, Felix von Weingartner, der sie zur Aufführung an diesem Institut annahm. Aber kurz darnach quittierte Weingartner seinen Posten, und damit war auch der Traum des „Fernen Klangs“ ausgeträumt. Da wies eine Sängerin, Melitta Heim, den Dirigenten der Frankfurter Oper, Ludwig Rottenberg, Paul Hindemiths späterem Schwiegervater, auf das Werk hin. Rottenberg fing Feuer, und die Uraufführung des „Fernen Klangs“ am 18. August 1912 wurde zu einem beispiellosen Triumph für Schreker und sein Werk. Schreker wurde im gleichen Jahr als Lehrer an die Akademie der Tonkunst in Wien berufe sein Name hatte internationalen Klang bekommen, Not und Verzweiflung der Jugendzeit lagen hinter ihm wie ein böser Traum.
Nimmt man die heute fast vergessene Partitur des „Fernen Klangs“ zur Hand, so zeigt sich, daß Schreker in dem ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts die Auflösung der Tonalität bereits bis zu einem Punkt vorangetrieben hatte, der noch über die „Salome“ von Strauss in gewissem Maße hinausging. Schrekers Revolution leitet sich aber nicht aus der weiteren Steigerung der Melodik und Harmonik des Tristan ab, so wie dies offensichtlich bei Strauss und zunächst auch, einschließlich „Pelleas und Meli-sande“, bei Debussy war — Schreker revolutioniert die Musik aus der Idee des Klangs. Klang an und für sich, unabhängig von irgendeiner Melodik, allenfalls gebunden an harmonische Phänomene, wird zum Selbstzweck erhoben. Schreker äußert sich selbst über dieses Problem: Der reine Klang, ohne jede motivische Beigabe, ist, mit Vorsicht gebraucht, eines der wesentlichsten musikdramatischen Ausdrucksmittel, ein Stimmungsbehelf ohnegleichen. Ihn übertrifft an Wirkung vielleicht nur — die Stille.
In seiner Oper „Der ferne Klang“ wird dieser Klang, der bei Schreker Urmotor der Musik ist, auch zum dramaturgischen Drehpunkt des Werks erhoben. Fritz, der junge Künstler, der seine Liebste, Grete, die in engen bürgerlichen Verhältnissen lebt, verlassen will, um den geheimnisvollen Klang zu suchen, der so seltsame Sehnsucht in ihm erweckt, faßt das in die Worte: „Nicht Ruhe finde ich zu Glück und Genuß, nicht Ruhe zu Liebe und Seligkeit, ehe ich ihn nicht habe und halte, den rätselhaft weltfernen Klang, der zu mir herübertönt so eigen — weißt du, Gretel, wie wenn der Wind mit Geisterhand über Harfen streicht. Weit — weit —.“
Nach dem unwahrscheinlichen Erfolg des „Fernen Klangs“ in Frankfurt kam dort, gleichzeitig mit der Wiener Staatsoper, auch Schrekers nächste Oper, „Das Spielwerk und die Prinzessin“, zur Uraufführung. In Frankfurt gab es einen Achtungserfolg, in Wien einen Theaterskandal. Doch dies konnte Schreker nicht mehr entmutigen. Am Tag nach dem Skandal begann er jenes Werk, das ihm den größten Ruhm als Komponisten einbrachte: „Die Gezeichneten.“ Noch vor dem Krieg war es vollendet. Aber der Krieg war der erste empfindliche Rückschlag für Schreker. Er unterbrach nicht nur die Aufführungsserie des „Fernen Klangs“ in Frankfurt, Leipzig und München, er verhinderte auch die Neuaufführungen in Breslau und Prag und vor allem an der großen Oper in Paris. Auch die „Gezeichneten“ blieben zunächst im Schreibtisch des Autors liegen. Aber dann brachte ihre Uraufführung im April 1918 in Frankfurt Schreker einen frenetischen Erfolg. Bald, nach der ebenfalls in Frankfurt stattgefundenen Uraufführung der nächsten Oper, des „Schatzgräbers“, zählte Schreker zu den meistgespielten lebenden Opernkomponisten. Die äußeren Ehren wachsen. Karlsruhe will ihn 1920 zum Generalintendanten machen. Da wird er an die Berliner Hochschule für Musik als deren Direktor berufen. Schreker verläßt Wien, die Stadt, die auch ihm, wie so vielen ihrer besten Söhne, keinen Dank wußte, und verbringt nun die Jahre bis zu seinem Tod in Berlin.
War Schrekers Wirkung als Komponist auf die Weiterentwicklung der Neuen Musik nur von der kurzen und leuchtenden Art eines Meteors, so hat Schrekers Tätigkeit als Direktor der Berliner Hochschule einen außerordentlichen Einfluß auf die Weiterentwicklung nicht nur der deutschen Musik gehabt. Es gelang Schreker in Kürze, aus einem belanglosen und verstaubten Institut eine der führenden musikalischen Bildungsstätten der Welt zu machen. Er fesselte außerordentliche Lehrer an sein Institut. Der Geiger Karl Flesch, der Cellist Emanuel Feuermann, der Pianist Arthur Schnabel seien aus der Liste der ganz Großen genannt, die Schreker als Lehrer zu gewinnen wußte. Für seine Weite der Sicht zeugt, daß er Paul Hinde-mith, die ihm wohl diametral entgegengesetzte Persönlichkeit, als Kompositionslehrer an seine Anstalt berief.
Wer nun die früheren Opern Schrekers kennt, wird es kaum für möglich halten, daß der Autor dieser zerfließenden Kunst einer der wenigen genauen Kenner des echten modalen Kontrapunktes war. Aber so ist es wohl erklärlich, daß viele seiner Schüler, unter denen sich zahlreiche bedeutende Namen finden, vor allem Ernst Krenek, ihr eigenes Werk in einer Sprache begonnen haben, die nichts vom Klangrausch Schrekerscher Opernpracht, aber alles von der herben und schmucklosen Sprache der Kirchentonarten hernahm. In den letzten Opern Schrekers, im „Christopherus“, im „Singenden Teufel“ und im „Schmied von Gent“, tritt an die Stelle des Klangrausches und der Farbenpracht, die noch Schrekers populärstes Werk, den „Schatzgräber“, beherrschten, eine Art von archaischer Strenge und Kargheit, die zwar auch weit in die Zukunft wies, die aber zu ihrer Zeit völlig mißverstanden wurde.
Nachdem Schrekers frühere Opern durch alle großen Opernhäuser der Welt mit märchenhaftem Erfolg gegangen waren, mußte Schreker erleben, daß in den Jahren, in denen der Nazismus immer mehr an Terrain gewann, seine beispielsweise in Freiburg 1931 zur Uraufführung angenommene Oper „Christopherus“ angesichts der drohenden nazistischen Demonstrationen zurückgezogen werden mußte. Schon 1932 wurde durch beispiellose Angriffe und Intrigen Schrekers Pensionierung als Hochschuldirektor erzwungen. Im Dezember 1933 brachte ihm die Nachricht der endgültigen Amtsenthebung den seelischen und körperlichen Zusammenbruch. Er siechte nach einem Schlaganfall dahin und wurde durch den Tod, der ihn am 21. März 1934 ereilte, vor weiterer Schmähung und vor Schlimmerem bewahrt. Schrekers Auswirkung war bereits mit seiner Pensionierung als Hochschuldirektor völlig abgeschnitten worden. Aber sie wirkte latent weiter. Heute zeigt es sich, wieviel davon seine Schüler, unter ihnen Komponisten vom Range Alois Häbas, Karol Rathaus', Ernst Kreneks, Dirigenten von der Bedeutung Hans Schmidt-Isserstedts und Jascha Horensteins, in ihr Wirken aufgenommen haben.
Aber auch von Schrekers Werk selbst sind heute die Dinge, die ihm zwar zunächst den frenetischen Erfolg, dann Mißtrauen und Ablehnung und schließlich Vergessenheit eingetragen haben, abgefallen oder ins Nebensächliche abgewandert: Rausch und Eros, Puccini-sche Gefühlsüberseligkeit der Melodik und gewagte erotische Haltung der Texte, das alles ist ziemlich belanglos dem gegenüber, daß Schreker in seinen Werken jene Lösung auf dem Weg zur Liquidierung der Tonalität gefunden hat, die der geniale Debussy für Frankreich gleichfalls entdeckt hat. Eine Schreker-Renaissance wäre heute nicht nur an der Zeit, sie würde nicht nur in den früheren Opern, sondern auch in der „Kammersymphonie“ äußerst lebenskräftige Musik zutage fördern, die heute weit zukunftsweisender anmutet als vieles, das man zur Zeit ihrer Entstehung für besonders revolutionär hielt. Eine solche Schreker-Renaissance müßte auch in den späten Opern und in den hochinteressanten späten Orchesterstücken Dinge zutage fördern, die zeigen, daß der Weg des mittleren Strawinsky zum Klassizismus keine vereinzelte Erscheinung war. Eine Schreker-Renaissance müßte endlich heute das wiedergutmachen, was Mißverständnis und Brutalität an einem schöpferischen Künstler gesündigt haben, der schließlich einmal keineswegs hinter Richard Strauss und, wenn auch nur kurze Zeit, in einer Reihe mit Schönberg gestanden war.