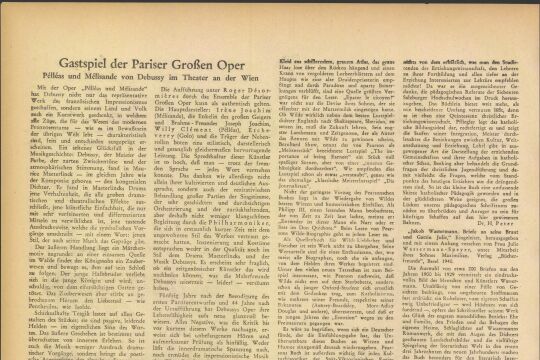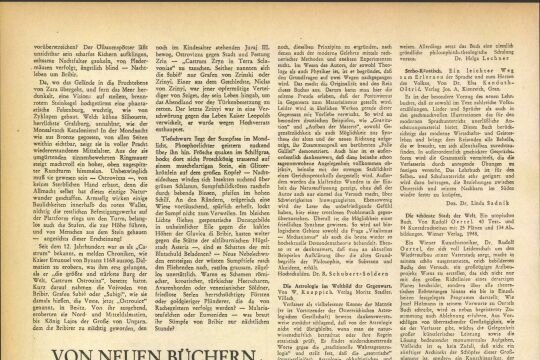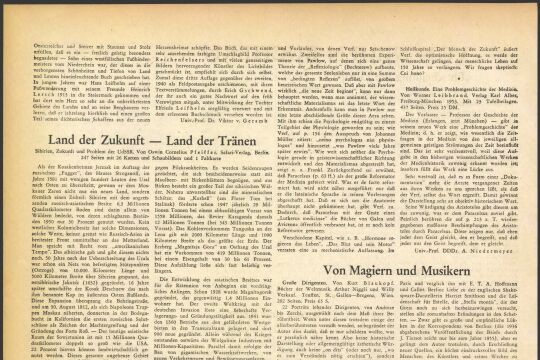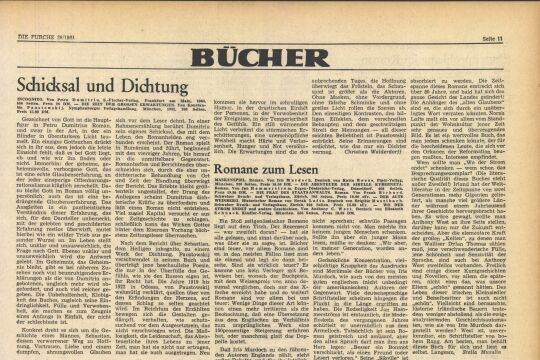Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die fatalen Träume der Urgroßväter
Literaturpreise sind sensible Anzeiger für Autoren, den Zeitgeschmack, aber auch für atmosphärische Zusammenhänge.
Steven Millhauser hat kürzlich den Pulitzer-Preis für Relletristik erhalten. Auf deutsch gibt es nur seinen letzten, nun preisgekrönten Roman „Martin Dressler - Ein amerikanischer Träumer”. Der Verlag hatte rechtzeitig klimatisches Gespür.
Der Autor, Jahrgang 1943, ist Professor für Englisch an einem East-coast-College. Sein erster Roman erscheint 1972, zwei weitere und Short Stories folgen. Ein überschaubares Werk. Die amerikanische Kritik ist zurückhaltend, sie sieht alles folgende im Schatten des hochgelobten Erstlingsromans. Vielleicht ändert sich das jetzt.
Die Romanfigur Martin Dressler, Jahrgang 1872, ist Sohn eines kleinen New Yorker Zigarrenhändlers, steigt klassisch-amerikanisch auf vom Liftboy zum Ilotelmogul. Der junge sympathische Gentleman hat die rechte Mischung aus Geschäftssinn, Organisationstalent und Charme, „die Menschen mochten ihn; er konnte es tief im Innern fühlen”. Sein Erfolg ist an den Stockwerken seiner Hotels abzulesen: von fünf beim ersten bis zu 42 ein paar Jahre später. Er träumt und verwirklicht den Traum vom unbegrenzten Wachstum, baut Illusionsund Theaterwelten, gigantische Vergnügungskosmen, auf die die Zeitgenossen gierig ansprechen. Der Träumer inszeniert das Fin de siecle: gotische Gobelins auf Stahlbeton, HighTech im Märchenschloß, Disneyland damals schon. Aber er träumt zu weit über das Profitable hinaus und merkt nicht, wie sich sein Gesamtkunstwerk entvölkert. Mangels Kunden stellt er schließlich Schauspieler ein, um seinen Traum zu stützen. Doch die Statik seiner Sehnsüchte ist schwächer als die seiner Wolkenkratzer, sein Imperium verliert den inneren Halt und entgleitet ihm. Der Millionär verdämmert als Fünfund-dreißigjähriger in seinem Park, leergeträumt wie ein Achenbach.
Die Stärken des Ruchs liegen nicht in der Konstruktion dieser Geschichte, die eher wie ein schwaches Libretto einer Oper wirkt. Viel mehr Gewicht liegt in der großartigen Ausstattung. Die Rühnenbilder sind bis ins Detail ausgeführt: Kostüme, Requisiten, Zeitgeschichte, alles echt. Seitenlang wird eine Schaufensterdekoration, die Hutmode oder ein Vormittag in der Hotellobby beschrieben. Schwelgen in Genauigkeit. Ähnlich genau ausgezirkelt sind die Aktionen und Situationen, Martin als guter Junge guter Eltern, die sich langsam füllende Ruhne - Freunde, Geschäftspartner und seltsame Frauen, von denen er die seltsamste dummerweise heiratet. Choreographie eigenwilliger Solisten.
Alle Figuren sind fiktiv, doch der gebildete Amerikaner wird viele Vorlagen erkennen. Dem Europäer gelingt dies stellenweise. Des Hotelbauherrn Stararchitekt Arling etwa hat „in Wien als Rühnenbildner angefangen”. Die lange Reschreibung im Roman paßt ausgezeichnet auf Joseph Urban, den Regründer des Hagenbundes, der Opernausstattungen für Gustav Mahler geschaffen hat und dann auswanderte. Das prächtige Konterfei dieses Urban/Arling findet sich heute noch im Marc Anton der Löwengruppe vor Wiens Secession. Derart sind im Roman New Yorker und Wiener Stadtgeschichte beiläufig fein verknüpft. Elogen der Neuen an die Alte Welt, die sich vergnüglich lesen. Das Ruch als Ganzes ist ein Rei-spiel, wie minutiös und ernsthaft sich das akademische Amerika dieser Jahrhundertwende mit der vorangegangenen beschäftigt und dabei in den Träumen der Urgroßväter das fatal Fortschrittsträumerische von heute recht deutlich vorgezeichnet findet.
Die Pulitzer-Juroren haben mit der Auszeichnung dieses Romans offensichtlich auf dieses Atmosphärisch-Aktuelle sensibel angesprochen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!