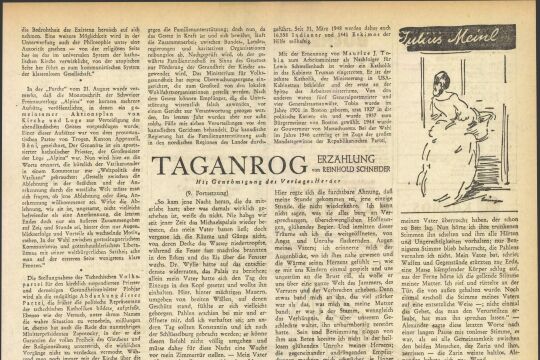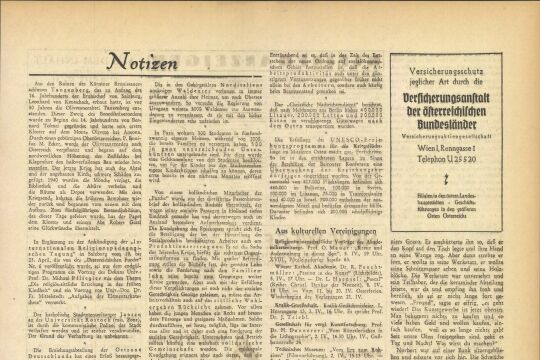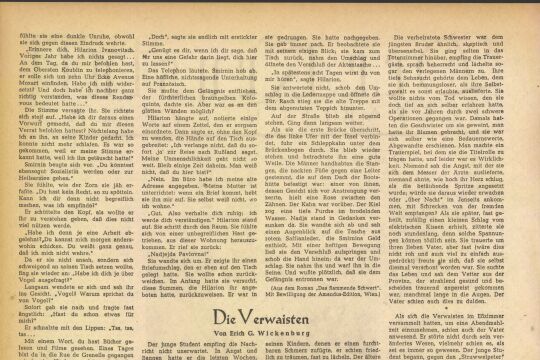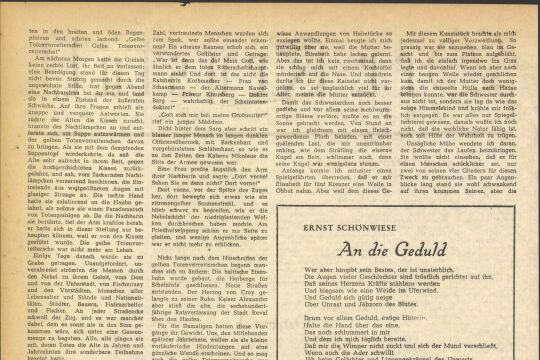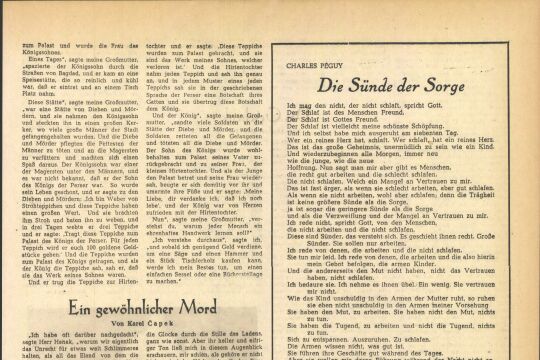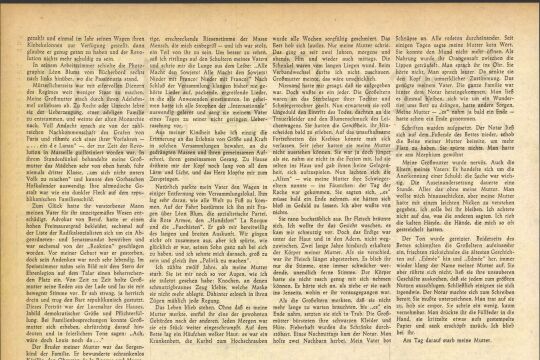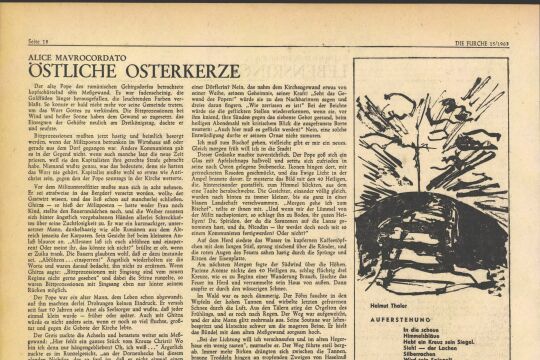Die Einsamkeit Tobias Klemms, ja, das war Einsamkeit!
Er lebte in einer Stadt von zwei Millionen Menschen; aber es war so gar keine Beziehung zwischen ihm und ihnen, daß er sich diese zwei Millionen nicht als eine Summe von Einzelwesen denken konnte, sondern nur als eine formlose Masse, gehüllt in einen schweren Nebel von Atem und Ausdünstung.
Er war Schreiber in einem kleinen Amt, mied seine Kollegen und wurde von ihnen nicht beachtet. Keiner sprach ein überflüssiges Wort zu ihm. Bei einer alten Frau, die in Häuser waschen ging, logierte er. In dem trübseligen Zimmerchen standen Möbel, die aussahen wie die Leichen von Möbeln. Jedenfalls hatte Klemm auch zu ihnen keine Beziehung. Wenn sein Bett unter ihm knarrte, empfand er das als einen feindseligen Akt. Die Kerze, die ihm des Abends leuchtete, brannte verdrießlich und unwirsch, als ob es sie ärgere, ihm zu dienen. Der Spiegel erblindete absichtlich, um Klemms Gesicht nicht deutlich wahrnehmen zu müssen.
Klemm war mehr als fünfzig Jahre alt. Seit vielen Jahren lebte er so, ohne Freund, ohne
Frau. Niemand kümmerte sich um ihn. Einmal wurde er als Zeuge eines Straßenbahnunfails vor Gericht geladen, und an diesen Tag dachte er noch lange. Denn da fragte man ihn, wie er heiße und wo er wohne, und wann er geboren sei, kurz, seine Existenz hatte für irgend jemand Bedeutung an diesem Tage. Im Wirtshaus, wo er seinen Mittagsstammtisch hatte, setzte kein Mensch sich zu ihm. Kein Kellner tat vertraulich. Er hing dort in seiner Ecke wie die Spinnennetze, die ziemlich zur selben Zeit mit ihm in die Wirtsstube eingezogen waren, in der ihren; ein grauer Fleck mit etlichen Leben mittendrein. Etwas, das bestand, nur weil die Umwelt zu faul oder zu gleichgültig war, es wegzuputzen.
Eines Tages las er in der Zeitung, die Frau des Zigarrenhändlers Robinson, Maria, habe Selbstmord begangen, und der verzweifelte Gatte wisse nicht, warum. Robinson war Klemms Schulkamerad gewesen, und Klemm hatte um seine Freundschaft geworben. Aber vergeblich. Und als in späteren Jahren doch etwas wie Freundschaft zwischen den beiden zustande kommen wollte, da war Maria dazwischengetreten und hatte den Freund für sich gewonnen. In der Nacht, die der Selbstmordnachricht folgte, träumte Klemm absonderliche Dinge. Er sah sich als die Ursache von Frau Robinsons Selbstmord, und in der verworrenen Logik des Traums spannen sich Fäden zwischen, jenem Vorfall und Klemms einstigem Werben um den Jugendgefährten. Er träumte sich als Leidtragender bei Marias Begräbnis, und über die klaffende Erde hinüber, in die die Tote hinabgesenkt worden war, reichte ihm der Zigarrenhändler die Hand, ihre Stirnen berührten einander, und gemeinsam flössen ihre Tränen in die Gruft. So standen Chingachgock und Lederstrumpf über Inkas, des letzten Mohikaners, frischem Grab. Und dann hob Robinson das Haupt und sah Klemm mit Augen an, in denen das Naß einer zweifachen Rührung schimmerte: der Trauer und der Freundschaft.
An diesem Tage schrieb Klemm dem Witwer einen Brief, in dem er sich der Schuld an Marias Selbstmord bezichtigte. Er hatte sich hierzu eine komplizierte, romanhafte Erzählung ausgedacht, redete von Klemm in der dritten Person und ließ den Brief ohne Unterschrift, so, als ob ihn ein Fremder geschrieben hätte. Der Einsame, den keiner mochte, warb um ein Stückchen Haß. Er trug den Brief zur Post und wartete, was nun kommen würde. Er patrouillierte vor Robinsons Haus und freute sich auf die Begegnung, auf die schreckliche Zwiesprache, auf den Faustschlag ins Gesicht und den warmen Regen der Schimpfworte. Aber Robinson ging, am Arm eines wachsamen Herrn, stumm vorbei, mit leerem Blick und einem schiefen Lächeln. Andern Tags las man in der Zeitung, der Zigarrenhändler sei über den Verlust seiner Frau wahnsinnig geworden.
Das war ein harter Schlag für Klemm. Nun stand er wieder da und hatte nichts. Nun gerannen Tage und Nächte wieder zu einer breiigen Masse, die schweigend vor ihm auseinanderwich und hinter ihm sich schweigend wieder schloß. Er selbst war nur ein Klümpchen verhärteter Zeit, bestimmt, sich allmählich und spurlos in die Unendlichkeit aufzulösen.
Er sah Gedränge auf der Straße und mischte sich unter die Leute. Eine Frau klammerte sich an seinen Arm, und ein Mann stützte sich auf seine Schulter, um besser zu sehen, was vorgehe. Klemm hatte einen guten Augenblick. Er fühlte mit Behagen die Hände, die ihn als Stütze gebrauchten. Die Leute schrien aufgeregt, und er schrie mit, ohne zu wissen, weshalb man schrie. Dann sah er berittene Polizei herankommen. Das C?&h£?:#hwoll zu'eiflHeulelPWW Klemm heulte, daß ihn“ Kehle und Lunge sclfmerzten. Jetzt fielen Schüsse. Der Menschenknäuel, von Angst erfaßt, wurde um und um gewirbelt, in Stücke zerfetzt und die Fetzen nach allen Windrichtungen auseinandergeblasen.
Klemm landete in einer Nebengasse, keuchend, ohne Hut und Stock. Er hinkte in ein kleines Wirtshaus, das vollgepfropft war von Aufgeregten. Alle sprachen von dem Vorgefallenen. Klemm hörte zu, sprach dazwischen, trank und schlug mit der Faust auf den Tisch und trank. Es war ihm, als hätte er hier auf seiner langen Wanderung durch Öde und Dunkel eine Zuflucht gefunden. Die ganze Nacht blieb er, schreiend und trinkend. Dann verzogen sich die Gäste, und draußen schlich schon das Tageslicht um das Haus, ein Scherge der Einsamkeit, die ihren Gefangenen wiederhaben wollte.
Als Klemm heimwärts ging, sah er im Fenster eines Zeitungsladens die „Illustrierte Tageszeitung“ hängen. Ein großes Bild schmückte ihre erste Seite... sein eigenes Bild. Sein Jugendbild mit dem kurzen, runden Vollbart, wie er es daheim über dem Bett festgemacht hatte. Und unter dem Bild stand mit fetten Buchstaben: Tobias Klemm.
Fünfzehn Jahre lang wohnte Klemm in der gleichen Stube, und während dieser ganzen fünfzehn Jahre war er nicht ein einziges Mal über die Zehn-Uhr-Abendstunde ausgeblieben. Als es in jener ereignisreichen Nacht elf und zwölf geworden, lief die besorgte Wirtin zur Polizei und meldete den Abgang ihres Mieters. Man sagte ihr, bei den Straßenkrawallen sei ein Mann erschossen worden, auf den ihre Schilderung des Vermißten so ziemlich zutreffe. Dann setzte man sie in einen Wagen, und der Detektiv fuhr mit ihr in das Totenschauhaus. Die gute Frau zitterte vor gruseligem Behagen beim Gedanken an die Möglichkeit, daß ihr Zimmerherr der Tote sein könnte, und, alle Wonnen der nachbarlichen Neugier und des Aufsehens und der vielen erregten Debatten vorschmeckend, waren in ihrem Bewußtsein der Tote und Klemm längst eins geworden, als der Wagen vor dem Schauhaus haltmachte. Sie sah kaum auf die Leiche hin, band mit zitternden Fingern das Kopftuch fest, schluckte vor Erregung und rief einmal um das andere Mal: „Freilich is' er's . ..“ und: „Na so was!“ und noch viele Male „Na so was!“ Und diese Nacht würde die Gute ohnehin nicht mehr geschlafen haben, auch wenn nicht der unerbittliche Reporter der „Illustrierten Zeitung“ bei ihr erschienen wäre und sich ein Bild des toten Klemm ausgebeten hätte.
Solcherart also erfuhr Klemm aus der „Illustrierten“, daß er gestern totgeschossen worden war, als Opfer im Kampf um Freiheit und Recht. Er kaufte noch andere Zeitungen. Klemm, überall Klemm. Dem Vorkämpfer für Freiheit und Recht wurde schwach zumute; er mußte einen Schnaps trinken. Wovon sprach man in der Schenke? Von Klemm, dem Opfer im Klassenkampf. Und wie man von ihm sprach: mit Ehrerbietung, mit Wärme, mit Rührung. Und bei den Zeitungskiosken, um sein Bild mit dem kurzen Vollbart geschart, standen die Leute und sagten: „Jaja.“ Gestern noch ein Niemand, ein Nichts, heute der Gegenstand des Interesses von hunderttausenden. Als ob eine unsichtbare Riesenglocke, „Klemm“ schmetternd, durch alle Straßen läute, so dröhnte die Stadt von diesem Namen. Und Klemm, wonnig betäubt von dem Gedröhne, beschloß, die Seligkeit noch ein Weilchen auszukosten, vorderhand nicht nach Hause zurückzukehren und tot zu bleiben.
In den folgenden Tagen, da er, kein Geld mehr in der Tasche, in Asylen nächtigte, in diesen Tagen sah.er seinen Ruhm gewaltig anschwellen. Die Kollegen im Amt hatten den Zeitungen viel von ihm erzählt, und Klemm war sehr ergriffen, wie nett sie sich über ihn äußerten. Die Wirtin war unermüdlich in der Beibringung kleiner Züge seines großen Charakters. Er selbst, Klemm, erzählte den Leuten gerührt von Klemm, den er so gut gekannt hätte wie kein anderer. Die Augen gingen ihm über, und die vielen Falten und Fältchen seines alten Gesichts waren wie ein System von Kanälen, das dem Bartgestrüpp Bewässerung zuführte. Als er bestattet wurde, stand er in den vordersten Reihen der Leidtragenden. Viele Menschen füllten die breiten Wege zwischen den Gräbern. Auf einer schwarzbehängten Kiste stand ein Mann und schrie: „Denn er war unser!“ Alle weinten, und Klemm so laut, daß die Umstehenden ihn ansahen und sich zuflüsterten: „Der muß ein naher Verwandter von ihm gewesen sein.“ Ja, das war er nun allerdings.
Den Höhepunkt erreichte Klemms Karriere, als im Parlament der Abgeordnete aufstand und sagte: „Wir rufen dem Herrn Minister nur ein Wort zu, ein Donnerwort: Tobias Klemm!“ Da-JnitjSfRÄ KJjumfet5c.hickBailiKefltschie4e.i[£r rfaefcsr tchlpß, jdie..Stellung, eines .Donnerwortes dauernde u -id&ähxmnveinB'i frühierei'. StellunägQlls'iAeeiierw Schall nie mehr wieder einzunehmen.
Eigentlich war Tobias, dem erbarmungslosen, innersten Gesetz seiner Existenz zufolge, jetzt noch einsamer als zuvor. Früher hatte er sich doch selbst gehabt, sein trübes, kleines Ich. Das hatte er jetzt nicht mehr. Früher hatte er einen Namen gehabt. Jetzt war der Name verloren. Er war von ihm gefallen, in Glorie zwar und Herrlichkeit, aber immerhin; er war fort. Was blieb übrig? Ein entklemmter Klemm, ein leeres Gerüst armer Menschlichkeiten. Und allmählich geschah es, daß in Klemms Seele Neid und Groll gegen den ermordeten Tobias aufkeimten. Er fing an, wie früher großartige, so jetzt bösartige Geschichten von dem Toten zu erzählen Da ging's ihm aber schlecht. Prügel und Hinauswürfe und böse Worte lohnten die Lästerung. Solches Unglück nährte seinen Haß, wie der Haß sein Unglück nährte. Er fühlte sich betrogen und be-stohlen von dem anderen, dem großen Klemm, und schmähte sein Andenken, wo er nur konnte. Als man ihn am Friedhof erwischte, wie er das Reliefbild auf Klemms Grabstein — es stellte einen idealisierten Männerkopf mit kurzgeschorenem Vollbart dar — unflätig bespülte, wollte man ihn einsperren. Er behauptete aber so hartnäckig, mit dem Grabstein könne er machen, was er wolle, denn er sei ja der, der drunter liege, daß man ihn ins Irrenhaus brachte.
Wen traf er dort? Robinson, den trauernden Witwer. Der Freund kniete vor einem Stuhl, das Haupt in den Rohrsitz gepreßt, die Arme zärtlich um die Stuhlbeine geschlungen. Klemm wurde feuerrot vor Eifersucht, wollte den Stuhl zertrümmern. Die Wärter sperrten ihn ins Isolierzimmer.
Dort starb er. Sie schafften ihn in die Leichenkammer, wo schon andere aufs gemeinsame Begrabenwerden warteten. Vorher aber erschien Doktor Holdenbeck (pathologische Anatomie) und reklamierte ihn für sein Seziermesser. Er klappte ihn auf, stöberte ein Weilchen neugierig in seinem Bauch umher wie in einer aufgesprengten Geheimtruhe, erkannte neuerdings den hohen Wert der Autopsie als diagnostisches Hilfsmittel, klappte Tobias wieder zu und ließ ihn zurückschaffen, von wo man ihn hergenommen hatte. Die anderen dort waren inzwischen schon begraben worden, und so wurde Klemm . zur letzten Ruhe allein gebracht: ein stilgerechter Abschluß seines ungeselligen Lebenswandels.