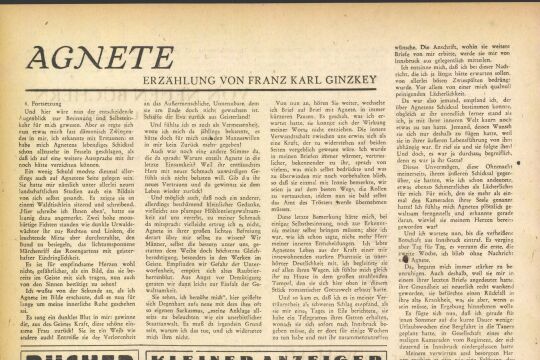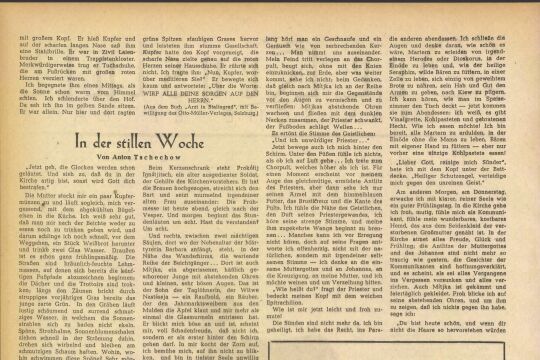Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
GEORGES BERNANOS
Ich bin kein Schriftsteller. Schon der Anblick eines weißen Blattes Papier quält meine Seele. Die physische Konzentration, die eine solche Arbeit fordert, ist mir so verhaßt, daß ich sie so lange wie möglich vermeide. Ich schreibe im Kaffeehaus, auf die Gefahr hin, für einen Säufer gehalten zu werden, und vielleicht wäre ich wirklich einer, wenn die allmächtigen Republiken die tröstende Alkoholika nicht unbarmherzig mit Steuern belegen würden. So konsumiere ich das ganze Jahr hindurch sänftlichen Milchkaffee mit einer ertrunkenen Fliege darin. Ich arbeite auf Kaffeehaustischen, weil ich nicht lange ohne menschliche Stimmen und Gesichter sein könnte, die ich nobel zu beschreiben mich bemühte. Mögen die Schlaumeier behaupten, ich „beobachte“, wie sie sich ausdrücken. Doch ich beobachte nicht, die Beobachtung führt zu nichts. Bourget hat ein Leben lang die Leute der Gesellschaft beobachtet, und doch ist er dem ersten Bild treu geblieben, das sich der kleine Repetitor mit seiner Sehnsucht nach englischem Schick von ihnen gemacht hatte. Seine sententiösen Herzöge gleichen Notaren, und wenn er sie natürlich darstellen will, macht er sie dumm wie Windhunde.
Ich schreibe in Kaffeehäusern, wie ich einst in der Eisenbahn schrieb, um mich nicht von imaginären Geschöpfen verleiten zu lassen, um mit einem Blick auf den Unbekannten, der eben vorübergeht, das rechte Maß der Freude oder des Schmerzes wiederzufinden. Nein, ich bin kein Schriftsteller. Wenn ich es wäre, so hätte ich nicht erst mit Vierzig mein erstes Buch veröffentlicht, denn schließlich werdet ihr mir vielleicht zugeben, daß ich mit Zwanzig ebensogut wie irgendein anderer die Romane Pierre Frondaies hätte schreiben können, übrigens lehne ich die Bezeichnung Schriftsteller nicht aus einer Art Snobismus mit umgekehrten Vorzeichen ab. Ich ehre einen Beruf, dem es meine Frau und meine Kinder nächst Gott zu verdanken haben, daß sie nicht Hungers sterben. Ich ertrage sogar in Demut die lächerliche Tatsache, die Ungerechtigkeit, cjeren dauerndes Ärgernis das Salz meines Lebens ist, bisher nur mit Tinte beschmiert zu haben. Jede Berufung ist ein Ruf — vocatus — und will weitergegeben sein. Deren, die ich rufe, sind allerdings nicht viele. Doch Ae sind es, sie sind es, für die ich geboren bin.
Das Leben bringt keine Enttäuschung, das Leben besitzt nur ein Wort, und das hält es auch. Die das Gegenteil sagen, denen kann ich nicht helfen. Sie sind Heuchler oder Feiglinge. Die Menschen, das ist wahr, enttäuschen, allein die Menschen. Auch denen kann ich nicht helfen, die diese Enttäuschung vergiftet: weil ihre Seele schlecht arbeitet, weil ihre Seele die Toxine nicht ausscheidet. Mich haben die Menscnen nicht enttäuscht, und ich selbst habe mich ebensowenig enttäuscht. Ich machte mich auf das Schlimmste gefaßt, das ist alles. Vor anderem sehe ich am Menschen sein Unglück. Das Unglück des Menschen ist das Wunder der Welt.
Aus „Die großen Friedhöfe unterm Mond', Verlag der Zwölf, München, Zwei-Berge-Verlag, Wien er den andern bevorzugte. Da erschien an einem Feierabend in seiner Werkstatt ein Einsiedler, ein uralter, gebeugter Mann mit schütterem, weißem Bart und abgetragenen Sandalen. Er bat um eine Geige. .Siehst du, Meister Francesco', so sagte der Alte mit hoher, schwankender Greisenstimme, ,die Augen sind mir erblindet, so viel habe ich geweint um meiner und der Menschheit Sünden. Und meine Stimme ist mir erloschen, ich kann keine Lieder mehr anstimmen zum Lobe Gottes. Gib mir eine Geige, Hochberühmter, ich bin des Spiels ein wenig kundig, ich will der Madonna und den Tieren des Waldes zum Preis und zur Freude spielen in der grünen Einsamkeit.' So sprach der Einsiedel und der Geigenbauer schenkte ihm die kostbare Meistergeige.
Viel später, nach dem Tode des Einsiedlers, ist die Geige in die Hände der Gelehrten gekommen. Sie erkannten das Meisterwerk, sie entzifferten aber auch den Spruch, den der Geigenbauer in die Zarge des Instruments geschnitzt hatte, einem wunderlichen Ornament gleich. Es war ein lateinischer Hexameter, der die Summe des Wissens und das Geheimnis des Geigenbauers und noch ein wenig mehr den Staunenden preisgab. Er lautete: VIVA SILVA TACUI, SED CAESA CARMINA CANO', das heißt auf deutsch etwa: Solang ich im Walde lebte, schwieg ich; gelallt jedoch, singe ich Lieder,
Verstehst du, mein Freund, den Sinn? auch ich habe, solange ich im Walde lebte, Baum unter Bäumen, Mensch unter Menschen, geschwiegen und Kraft gesammelt und Sonnenlicht, ohne zu ahnen, was das Schicksal mit mir vorhabe. Ich war sehend blind und glaubte, es komme auf die Maschinen an aus meines Vaters Fabrik. Dann hat die Axt des Schicksals mich gefällt, ungeheuerlichstes Leid zersägte mein Herz, ich bin nicht mehr, der ich war, und ich weiß kaum mehr, wer ich bin, ich; der ich glaubte, die Welt mit Webstühlen glücklich machen zu müssen und sie mir mit Geld Untertan machen zu können, sitze hier, ein hilfloser Blinder. Aber ich singe Lieder. Um den Preis des Baums singt das Instrument. Um den Preis des Lebens wird die Kunst. So und nicht anders.“
Der Freund schwieg und legte mir sanft den Arm um die Schulter. Durchs geöffnete Fenster drang nell und kräftig die Mittagsglocke.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!