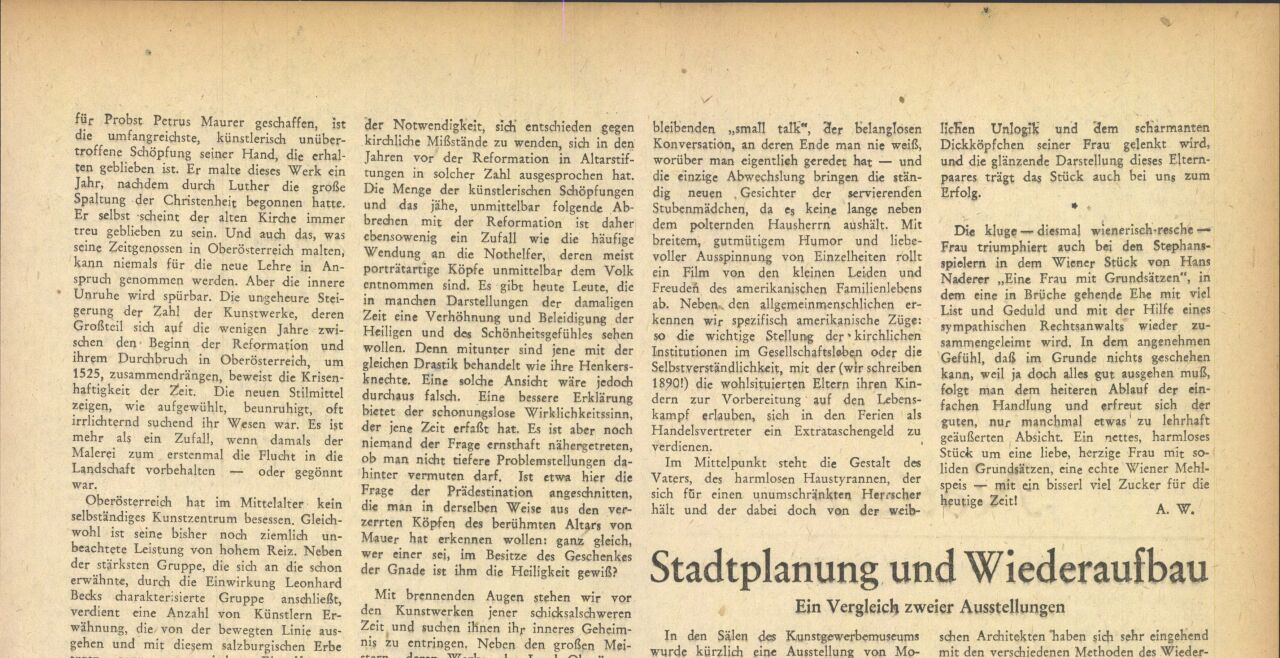
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Harmlose Heiterkeit
Auf die bittere Medizin deprimierender Nachtstücke und Moritaten, die die Wiener Theater dem sich heftig sträubenden Publikum zu Beginn der Spielzeit einflößten, folgt jetzt die fürsorglich bereitgehaltene Entschädigung: englische „Muffins“, amerikanische „Candy“-Stangen und Wiener Nußkipferln. Und wenn eine bösartige Kritik auch feststellen muß, daß die etwas altbackenen „Muffins“ nicht richtig serviert sind, daß die süße „Candy“-Masse zähe an den Zähnen klei>t, ja, daß selbst bei den Nußkipferln wohl ein paar Nüsse schon ein bisserl ranzig waren, so ändert das doch nichts an der Tatsache, daß es dem Publikum zu schmecken scheint — was bei den gegenwärtigen Ernährungsverhältnissen ja auch nicht weiter verwunderlich ist.
Die Insel bringt „Bunbury“ („The Im-portance of Being Earnest“) von Oscar Wilde — „eine triviale Komödie für seriöse Leute“, eines jener Gesellschaftsstücke, in denen sich der wilde Oscar als Salonlöwe zeigt — ein Löwe mit Samtpfötchen, unter denen allerdings doch die spitzig-witzigen Krallen seirfer vieldeutigen Ironie fühlbar werden. Diese Krallen, die nicht verletzen, sondern nur ein bißchen kratzen und kitzeln sollen, sind allerdings in der Aufführung nicht zu spüren. Gewiß ist Wilde heute nicht mehr leicht zu spielen in seinem geistreichen Spott über die“ blasierte „society“ — zu -der er selbst gehört —, in jener überlegenen und leicht gelangweilten Selbstironie, die grundsätzlich nichts ernst nimmt — weder das Stück noch den Zuschauer, am wenigsten sich selbst. Es ist ein ständiges Versteckenspielen zwischen Autor und Bühnenfigur, zwischen Schauspieler und Zuschauer, zwischen Witz und Ernst — ein höchst amüsantes, paradoxes Florettfechten, in dem nur touchiert, aber nicht wirklich gestochen wird. Denn „das Leben ist viel zu wichtig, als daß man je ernsthaft darüber sprechen sollte“, wie es in einer anderen Komödie des gleichen Autors heißt. Das leichte, huschende Spiel, das ironische Lächeln mit dem ganz verborgen in Mund- und Augenwinkeln lauernden Ernst verflüchtigt sich aber in dieser Aufführung, die die Lustigkeit zu ernst und die „Wichtigkeit des Ernstseins“ zu wichtig nimmt. Das Ernstnehmen des Humors, die seriöse Lustigkeit, töten den .ironischen Spott und die Komödie gerät nun wirklich in Gefahr, trivial zu wirken. Es wird frisch-fröhlich und ohne bösen Hintergedanken drauflosgespielt — was zwar nicht immer im Sinne des Autors, aber immerhin noch besser ist, als wenn man, ins andere Extrem verfallend, den sich in- spielerischer Freude am eigenen Glitzern entzündenden Witz, diesen „l'art-pour-l'art“-Spott etwa zu einer „satirischen Gesellschaftskritik“ aufgebläht hätte.
Wenn es dem fiktiven „Bunbury“ nicht gelingt, die dekadente Atmosphäre der englischen Gesellschaft im ausgehenden viktorianischen Zeitalter zu neuem Bühnenleben zu erwecken, so führt der „Herr im Haus“ mit energischem Schritt das „vergoldete Zeitalter“ der amerikanischen Gründerjahre in die Josefstadt. „Life with Father“ von Howard Lindsay und Rüssel ^ Crouse war in seiner Heimat ein großer Erfolg, pie „gay nineties“ — die fröhlichen Neunzigerjahre des vorigen Jahrhunderts sind ja für Amerika die „gute alte Zeit“, das verlorene Paradies für Operette und Revue — und in den letzten Jahren ganz besonders für den Farbtonfilm. Die Vorliebe für diese amerikanische „Backhendlzeit“ hat drüben viel zum Erfolg des Stückes beigetragen und auch in der Josefstadt vermag uns die in Kostüm und Darstellung eirtgefangene Zeitstimmung geschickt darüber hinwegzutäuschen, daß — wie so oft bei den Amerikanern — durch sieben lange Bilder hindurch eine Reihe netter Einfälle zu keiner Handlung verbunden sind. Immer wieder unterhält sich die Familie in demselben hübsch eingerichteten Zimmer bei der konventionellen Frühstückszeremonie in dem immer gleichbleibenden „small talk“, 3er belanglosen Konversation, an deren Ende man nie weiß, worüber man eigentlich geredet hat — und die einzige Abwechslung bringen die ständig neuen . Gesichter der servierenden Stubenmädchen, da es kein« lange neben dem polternden Hausherrn aushält. Mit breitem, gutmütigem Humor und liebevoller Ausspinnung von Einzelheiten rollt ein Film von den kleinen Leiden und Freuden des amerikanischen Familienlebens ab. Neben-, den allgemeinmenschlichen erkennen wir spezifisch amerikanische Züge: so die wichtige Stellung der kirchlichen Institutionen im Gesellschaftsle-ben oder die Selbstverständlichkeit, mit der (wir schreiben 1890!) die wohlsituierten Eltern ihren Kindern zur Vorbereitung auf den Lebenskampf erlauben, sich in den Ferien als Handelsvertreter ein Extrataschengeld zu verdienen.
Im Mittelpunkt steht die Gestalt des Vaters, des harmlosen Haustyrannen, der sich für einen unumschränkten Herrscher hält und der dabei doch von der weibliehen Unlogik“ und 'dem scharmanten Dickköpfchen seiner Frau gelenkt wird, und die glänzende Darstellung dieses Elternpaares trägt das Stück auch bei uns zum Erfolg.
Die kluge — diesmal wienerisch-resche — Frau triumphiert auch bei den Stephansspielern in dem Wiener Stück von Hans Naderer „Eine Frau mit Grundsätzen“, in dem eine in Brüche gehende Ehe mit viel List und Geduld und mit der Hilfe eines sympathischen Rechtsanwalts wieder zusammengeleimt wird. In dem angenehmen Gefühl, daß im Grunde nichts geschehen kann, weil ja doch alles gut ausgehen muß, folgt man dem heiteren Ablauf der einfachen Handlung und erfreut sich der guten, nur manchmal etwas' zu lehrhaft geäußerten Absicht. Ein nettes, harmloses Stück um eine liebe, herzige Frau mit soliden Grundsätzen, eine echte Wiener Mehlspeis — mit ein bisserl viel Zucker für die heutige Zeit!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































