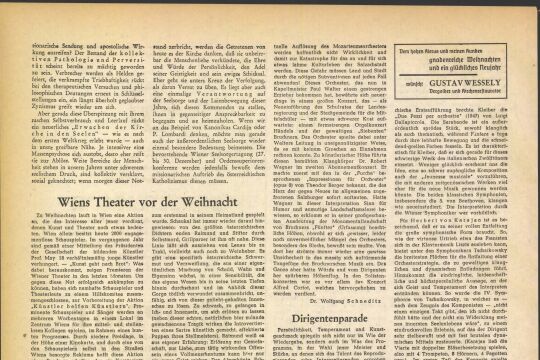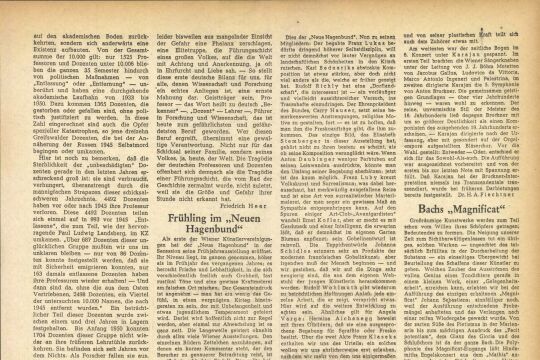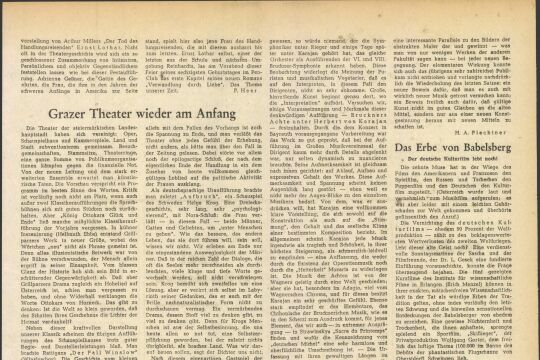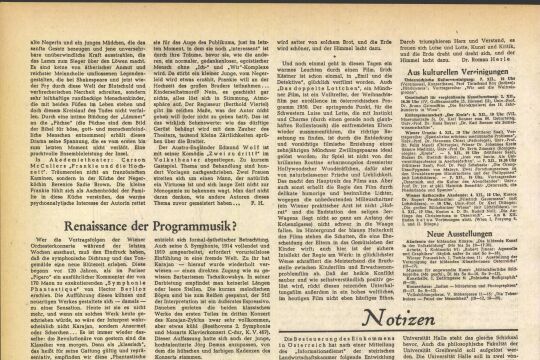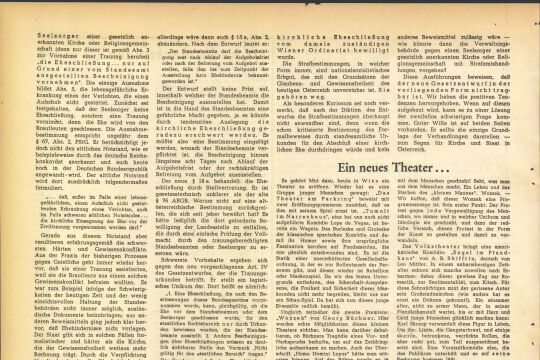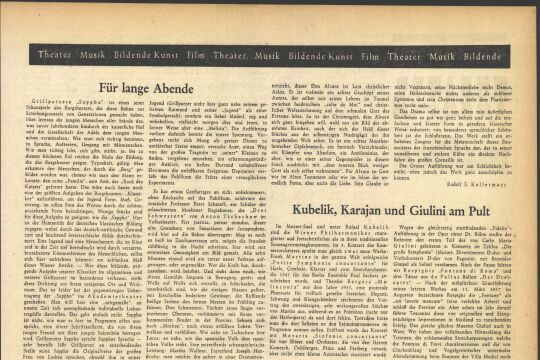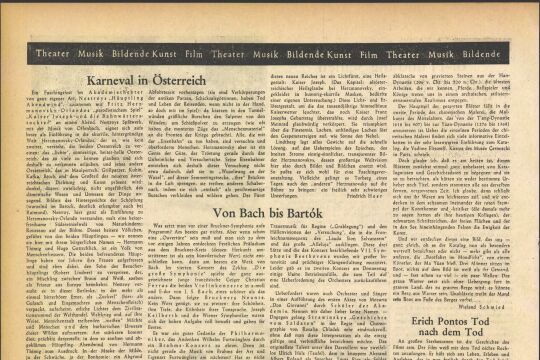Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
In abfallender Linie
Der „Ring“ hat sich geschlossen, eine gewaltige Anstrengung ihr Ende gefunden. Herbert von Karajan und seine Berliner Philharmoniker bedürfen der Erholung: Doch das Management eines (nur halben) Privatfestivals duldet keine Ruhepausen. Es rollt die D-Mark und es rotieren die Platten. Und der Terminplan eines Orchesters von Weltrang kennt keine Löcher, soll die Kasse stimmen.
Der „Ring“ hat sich geschlossen, eine gewaltige Anstrengung ihr Ende gefunden. Herbert von Karajan und seine Berliner Philharmoniker bedürfen der Erholung: Doch das Management eines (nur halben) Privatfestivals duldet keine Ruhepausen. Es rollt die D-Mark und es rotieren die Platten. Und der Terminplan eines Orchesters von Weltrang kennt keine Löcher, soll die Kasse stimmen.
Nun denn: Die Kasse ging in Ordnung. Auch die Applauszinsen waren hochprozentig. An Sympathie-Investment wurde nicht gespart. Dennoch lastete auf den beiden letzten Konzerten eine nicht geringe Hypothek. Sie wurde nicht verringert durch die Mitwirkung des Pianisten Christoph von Eschenbach, der so geckenhaft auftrat wie schülerhaft spielte. Was Mozarts A-Dur-Konzert, KV 488; seiner musikalischen Schönheit und seines lebhaften Geistes weitgehend entkleidete; das Engagement des jungen Herrn — jedermann wird sich hüten, hier von einem Mann zu reden, es wäre dem Schicklichen gegenüber unschicklich — das Engagement Eschenbachs bliebe jedenfalls ein Rätsel, wäre es nur eines. An der Wiedergabe von Bruckners IX. Symphonie ließ Karajan erkennen, welche Distanz ihn von einem Furtwängler, einem Schuricht trennt, wenn es gilt, einer Partitur ins Meta-
Herbert von Karajan physische zu folgen. Das Finale führte in eine Landschaft seelischer Dürre. Aber auch das Scherzo mißriet, wurde trocken, ohne jene ein wenig unheimliche rhythmische Intensität gespielt, die den Charakter des Satzes bestimmt. Eine eher mittlere Aufführung mit wenig Leuchtkraft in den Streichern und überraschenderweise auch bei den Flöten.
Im dritten Orchesterkonzert der Osterspiele folgte dem Mozart-Requiem, weil es unpassend, aber so der Brauch ist, Verdis Te Deum, mit dem der Maestro in ein jubilantes Finale einmündete. Der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde war Hauptakteur des Abends und zeichnete sich vor allem durch strahlende Fortissimo-Aus-brüche und hauchzarte Pianissimi aus. Von den Solisten war Helen Donath am besten und angenehmsten zu vernehmen und Werner Krenn, der versierte Stilist, fast überhaupt nicht.
Bas Berliner Orchester begleitete diszipliniert und akzentuiert nach dem Willen seines Herrn und Meisters die dramatischen Einwürfe mit Intensität.
Große Überraschung des Abends: Mozart lag Karajan nicht so sehr wie Verdi — nicht einmal Mozart plus Süßmayr.
Wendelin Frauenhof er *
Im Großen Festspielhaus leitete Karajan das erste der drei zyklischen Konzerte mit den Berliner Philharmonikern. Man muß ihm dafür dankbar sein, daß er sein Publikum mit einem der Meisterwerke der ersten Jahrhunderthälfte bekanntgemacht hat: Bela Bartöks Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta“ aus dem Jahr 1936. Sie entstammt Bartöks bester, „progressivster Zeit, ist ein Muster an Konzentration, gebändigtem Ausdruck und geschlossener Form. Alle nur erdenklichen Effekte bei der Behandlung der einzelnen Instrumente und Gruppen beherrscht der Komponist, aber er ordnet sie seiner Institution und der Architektur der vier Sätze unter. — Es war vorauszusehen, daß Karajan mit den Berlinern diese aus leidenschaftlichem Intellekt geborene Musik mustergültig interpretieren würde. Der Beifall, der wohl kaum dem schwierigen Werk allein gegolten hat, bestätigte es.
Danach wirkte die erste Symphonie von Brahms in c-Moll, etwa 60 Jahre früher entstanden und gleichfalls ein Meisterwerk ihrer Epoche, ein wenig altväterlich, romantisch-breit. Zu Brahms' Lebzeiten sprach man von der „Zehnten Beethovens“. Da hat aber Clara Schumann eher recht, die den Serenadencharakter der beiden mittleren Sätze erkannte... Zwei Posaunenstellen klingen so sehr an Bruckner und Wagner an, daß man wieder einmal sieht beziehungsweise hört, wie früher Antipoden nach einem knappen Jahrhundert bereits in brüderliche Nähe rücken. Klangkultur, Intensität und Ausdruck der Berliner waren bemerkenswert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!