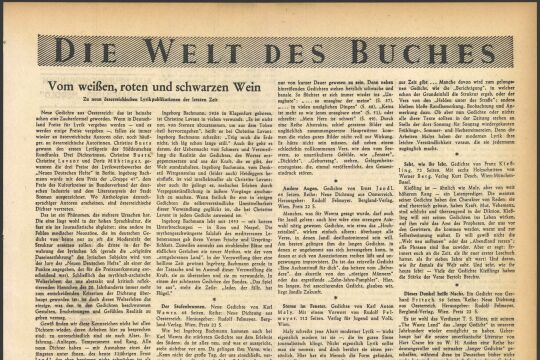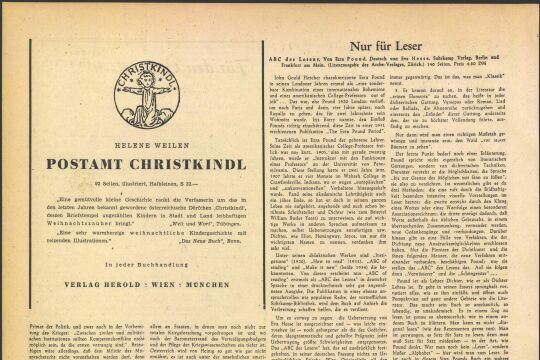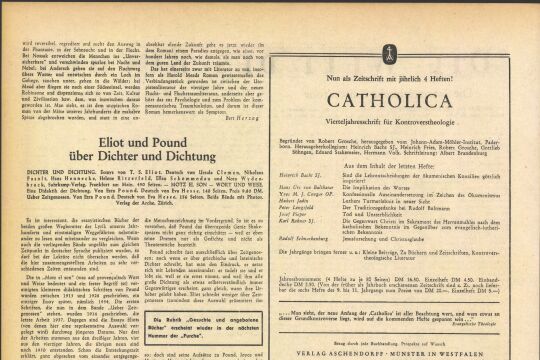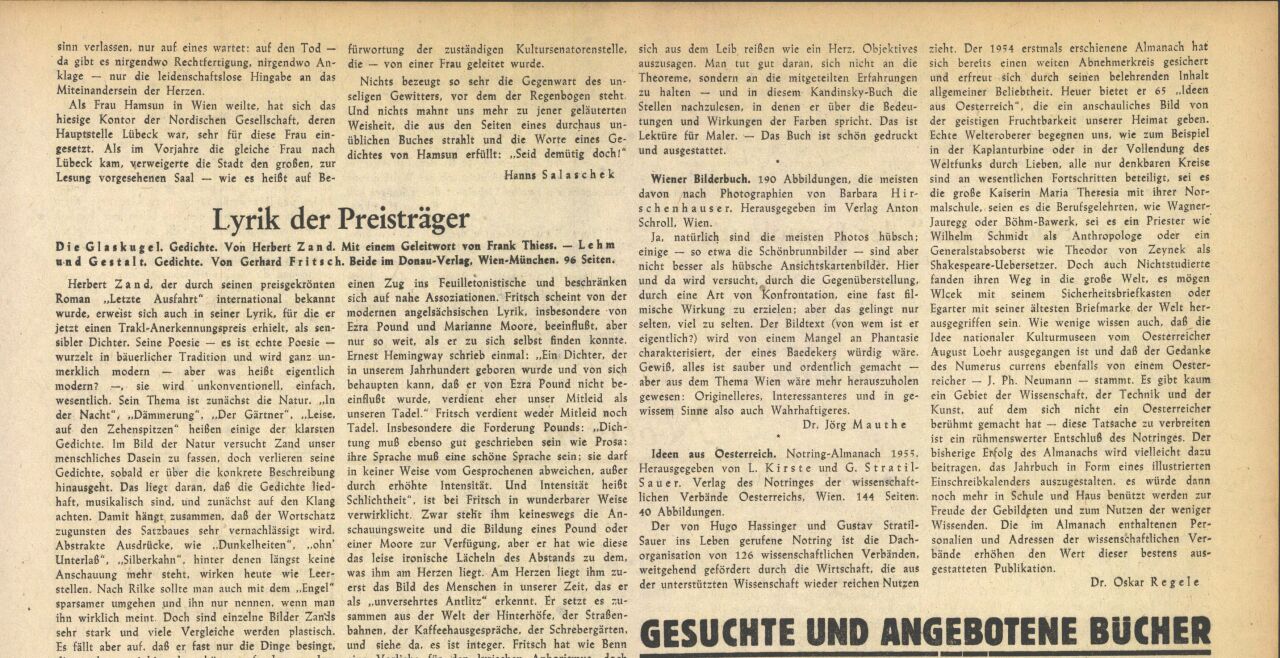
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lyrik der Preistrager
Herbert Zand, der durch seinen preisgekrönten Roman „Letzte Ausfahrt“ international bekannt wurde, erweist sich auch in seiner Lyrik, für die er jetzt einen Trakl-Anerkennungspreis erhielt, als sensibler Dichter. Seine Poesie — es ist echte Poesie — wurzelt in bäuerlicher Tradition und wird ganz unmerklich modern — aber was heißt eigentlich modern? —, sie wird unkonventionell, einfach, wesentlich. Sein Thema ist zunächst die Natur. „In der Nacht“, „Dämmerung“, „Der Gärtner“, „Leise, auf den Zehenspitzen“ heißen einige der klarsten Gedichte. Im Bild der Natur versucht Zand unser menschliches Dasein zu fassen, doch verlieren seine Gedichte, sobald er über die konkrete Beschreibung hinausgeht. Das liegt daran, daß die Gedichte liedhaft, musikalisch sind, und zunächst auf den Klang achten. Damit hängt zusammen, daß der Wortschatz zugunsten des Satzbaues sehr vernachlässigt wird. Abstrakte Ausdrücke, wie „Dunkelheiten“, ,,ohn' Unterlaß“, „Silberkahn“, hinter denen längst keine Anschauung mehr steht, wirken heute wie Leerstellen. Nach Rilke sollte man auch mit dem „Engel“ sparsamer umgehen .und ihn nur nennen, wenn man ihn wirklich meint. Doch sind einzelne Bilder Zands sehr stark und viele Vergleiche werden plastisch. Fs fällt aber auf. daß er fast nur die Dinge besingt, die auch gemeinhin als schön empfunden werden. Ein Gedicht wie „Hiob“ steht vereinzelt da. — Häßlicher Schutzumschlag.
Die originalere Begabung ist Gerhard F r i t s c h, der jetzt gemeinsam mit dem Lyriker Franz Kießling mit dem Förderungspreis der Stadt Wien für Dichtung ausgezeichnet wurde. (Zweifellos eine glückliche Wahl.) Fritschs Gedichte sind von einer wohltuenden Sachlichkeit, die nur sehr selten eine Nebensächlichkeit wird. Viele von ihnen haben einen Zug ins Feuilletonistische und beschränken sich auf nahe Assoziationen. Fritsch scheint von der modernen angelsächsischen Lyrik, insbesondere von Ezra Pound und Marianne Moore, beeinflußt, aber nur so weit, als er zu sich selbst finden konnte. Ernest Hemingway schrieb einmal: „Ein Dichter, der in unserem Jahrhundert geboren wurde und von sich behaupten kann, daß er von Ezra Pound nicht beeinflußt wurde, verdient eher unser Mitleid als unseren Tadel.“ Fritsch verdient weder Mitleid noch Tadel. Insbesondere die Forderung Pounds: „Dichtung muß ebenso gut geschrieben sein wie Prosa: ihre Sprache muß eine schöne Sprache sein; sie darf in keiner Weise vom Gesprochenen abweichen, außer durch erhöhte Intensität. Und Intensität heißt Schlichtheit“, ist bei Fritsch in wunderbarer Weise verwirklicht. Zwar steht ihm keineswegs die Anschauungsweite und die Bildung eines Pound oder einer Moore zur Verfügung, aber er hat wie diese das leise ironische Lächeln des Abstands zu dem, was ihm am Herzen liegt. Am Herzen liegt ihm zuerst das Bild des Menschen in unserer Zeit, das er als „unversehrtes Antlitz“ erkennt. Er setzt es zusammen aus der Welt der Hinterhöfe, der Straßenbahnen, der Kaffeehausgespräche, der Schrebergärten, und siehe da, es ist integer. Fritsch hat wie Benn eine Vorliebe für den lyrischen Aphorismus, doch wächst dieser immer organisch aus dem Bau seiner Gedichte und ist nie angeklebt. So ist alles bei ihm lebendig, der Neusiedler See ebenso wie Alexander der Große, und es entstehen viele einprägsame Zeilen, die im Gedächtnis bleiben. Diese vielleicht: „Deine Auferstehung liegt dir zu Füßen.“ Oder diese: „Dort redet Gott mit dem Wind — nicht mit uns. Groß ist die Gnade aber des Lauschens.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!