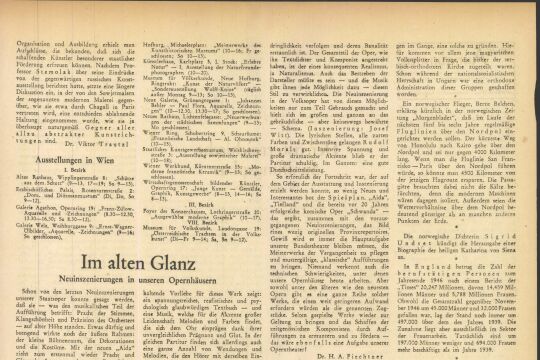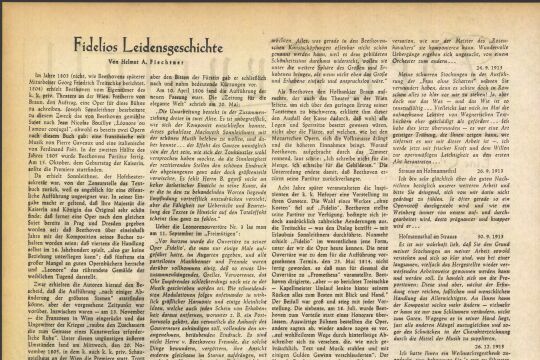Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Napoleon kam nach München
Die stets sehr schwer erreichbare Mühelosigkeit wäre der erste Pluspunkt für die heitere Oper „Napoleon kommt“ des jungen englischen Komponisten Richard Rodney Ben- nett, die jetzt im Münchner Nationaltheater zur deutschen Erstaufführung gelangte. Bennett, den wir als einen experimentierfreudigen Avantgardisten kennen, hat hier eine Musik ohne große Ansprüche geschrieben, eine Partitur, die auf moderne, aber auch für ein breiteres Publikum zugängliche Weise unterhalten möchte, ohne dabei den Text zu stören. Was sich als Ergebnis darstellt, läßt bisweilen an Henze denken, doch ist Bennett weniger kompliziert, seine Differenzierungen sind vom Zweck bestimmt, und doch ist sehr viel Sensitives, Inspiriertes in dieser Komposition, die sich immer in den Dienst des Textes stellt, ohne illustrativ oder dekorativ zu werden (Streicher und Holzbläser dominieren). Die außerordentliche Schwierigkeit ist es ja, der Spieloper eine ihr angemessene Form zu erhalten und nicht durch knallige „Nummern“ in die Bereiche des Musicals einzubrechen. Aber hier stellt schon der Text die entsprechenden Weichen, ein Libretto von bester Qualität, weder platt und dünn, noch literarisch-aufgeblasen, basierend auf John Whitings „A penny for a song“:
An einem Sommertag des Jahres 1804 erwarteten die Bewohner eines kleinen, am Kanal gelegenen Ortes der Grafschaft Dorset die Invasion Napoleons. Sir Timothy hat den Plan, der gefürchteten französischen Invasion ganz allein in den Rücken zu fallen. Dabei spielen ein Waffenrock Napoleons, ein Brunnen, ein unterirdischer Gang und schließlich sogar ein Ballon wichtige Rollen. Durch ein Mißverständnis glaubt der Sir, die Invasion habe begonnen und startet seine Aktion. So kommt es zu einem totalen Durcheinander, in welches sämtliche Familienmitglieder verwickelt werden. Erst ein Gespräch über Kricket — was auch sollte es unter Engländern anderes sein —?, stellt Ruhe und Ordnung wieder her. Ein sehr englisches Stück also, versponnen und spleenig, getragen von einer reizvollen Version über die „Entente cordiale“, die — augenblicklich von der politischen Bühne verbannt — auf der Bühne der Bayerischen Staatsoper eine liebenswürdige Wiederbelebung erfuhr.
Seit jener exemplarischen Realisation von Strawinskys „The Rake’s Progress“ wissen wir, daß dem Regisseur Günther Rennert das Skurrile ganz besonders liegt, und so war es zu erwarten, daß er sich für Bennetts „Napoleon kommt“ interessieren würde. Rennert und Bennett trafen sich denn auch im Geschmäck- lerischen. Was der Komponist diskret andeutete, kostete der Regisseur genüßlich aus, bimmelte ganz unaufdringlich am Silberglöckchen des humanen Engagements, ließ Richard Holm — der sich als eingebildeter, ultravornehmer Bruder Timothys in vortrefflicher Form zeigte — mit schadenfroher Ironie den tiefsinnigen Satz rezitieren: „Ich bin konservativ gewiß, trotzdem liebe ich die Menschen“, gab jedem Charakter seinen typischen Tick, verhalf dem Luftballon zum Aufwind, den Kanonenkugeln zum behäbigen Rollen und der Feuerwehrspritze zu Rauch und Gestank. Auch Rennert konnte nicht vermeiden, daß sich im zweiten Akt die Poesie bisweilen zur Sentimentalität neigte, aber sein angeborener Kunstsinn bewahrte ihn vor Gags und Drücker, die dieses feingewebte Opus überfrachtet hätten.
Der anwesende 30jährige Komponist konnte sich wohl keine glänzendere Interpretation seines Werkes wünschen, denn Rennert hatte neben dem feinnervigen Dirigenten Christoph von Dohnanyi und der phantasievollen Bühnenbildnerin Leni Bauer-Escy eine schier unübertreffliche Besetzung mit Ingeborg Hallstein, Martha Modi, Raimund Grumbach, Gerhard Stolze und anderen aufgeboten. Der Beifall war enthusiastisch, aber viele Theatersessel blieben leer, wie wird es da wohl in den Repertorire-Vorstellun- gen aussehen?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!