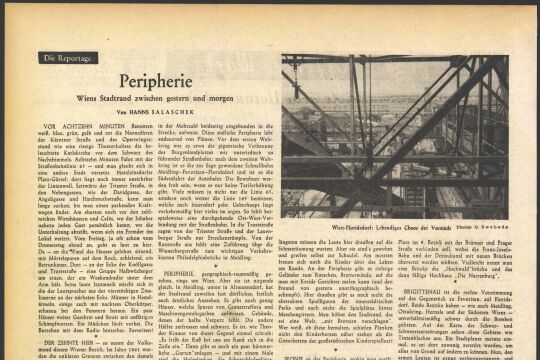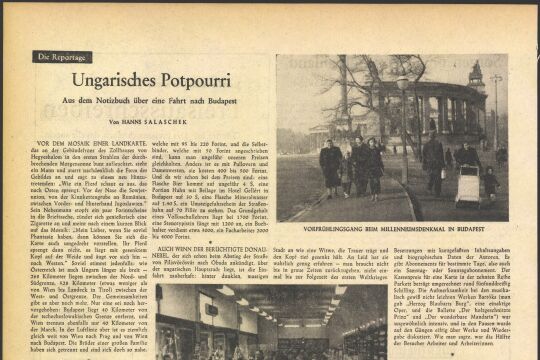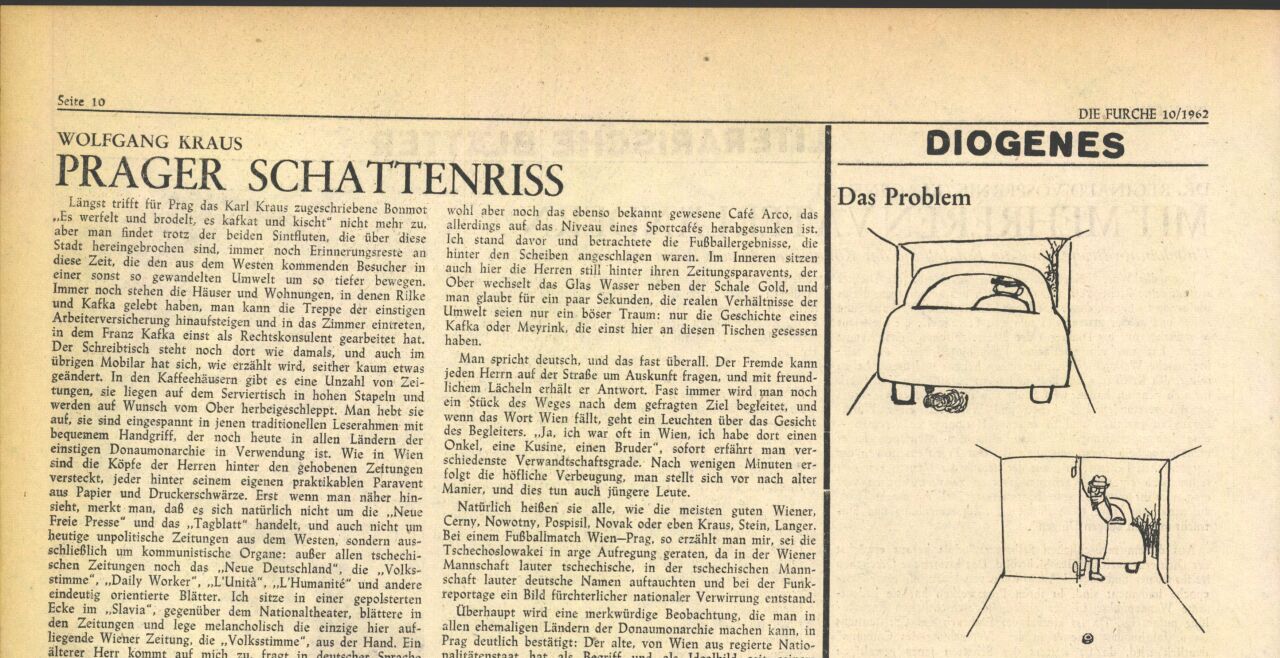
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
PRAGER SCHATTENRISS
Längst trifft für Prag das Karl Kraus zugeschriebene Bonmot „Es werfelt und brodelt, es kafkat und kischt“ nicht mehr zu, aber man findet trotz der beiden Sintfluten, die über diese Stadt hereingebrochen sind, immer noch Erinnerungsreste an diese Zeit, die den aus dem Westen kommenden Besucher in einer sonst so gewandelten Umwelt um so tiefer bewegen. Immer noch stehen die Häuser und Wohnungen, in denen Rilke und Kafka gelebt haben, man kann die Treppe der einstigen Arbeiterversicherung hinaufsteigen und in das Zimmer eintreten, in dem Franz Kafka einst als Rechtskonsulent gearbeitet hat. Der Schreibtisch steht noch dort wie damals, und auch im übrigen Mobilar hat sich, wie erzählt wird, seither kaum etwas geändert. In den Kaffeehäusern gibt es eine Unzahl von Zeitungen, sie liegen auf dem Serviertisch in hohen Stapeln und werden auf Wunsch vom Ober herbeigeschleppt. Man hebt sie auf, sie sind eingespannt in jenen traditionellen Leserahmen mit bequemem Handgriff, der noch heute in allen Ländern der einstigen Donaumonarchie in Verwendung ist. Wie in Wien sind die Köpfe der Herren hinter den gehobenen Zeltungen versteckt, jeder hinter seinem eigenen praktikablen Paravent aus Papier und Druckerschwärze. Erst wenn man näher hinsieht, merkt man, daß es sich natürlich nicht um die „Neue Freie Presse“ und das „Tagblatt“ handelt, und auch nicht um heutige unpolitische Zeitungen aus dem Westen, sondern ausschließlich um kommunistische Organe: außer allen tschechischen Zeitungen noch das „Neue Deutschland“, die „Volksstimme“, „Daily Worker“, „L'Unitä“, „L'Humanite“ und andere eindeutig orientierte Blätter. Ich sitze in einer gepolsterten Ecke im „Slavia“, gegenüber dem Nationaltheater, blättere in den Zeitungen und lege melancholisch die einzige hier aufliegende Wiener Zeitung, die „Volksstimme“, aus der Hand. Ein älterer Herr kommt auf mich zu, fragt in deutscher Sprache nach altem Wiener Brauch „ob das Blatt frei sei“. Wir wechseln ein paar Worte. „Wissen Sie“, höre ich, „die Zeitung kommt immerhin aus Wien, und ich habe gelernt, auch zwischen den Zeilen zu lesen.“ Befragt man über diesen Punkt einen näheren Bekannten, so erhält man eine Probe: „Wenn irgendeines dieser Orientländer umfällt, dann erkennen wir doch bald, nach welcher Richtung es fällt, auch wenn es uns verschwiegen wird. Heißt es zum Beispiel, die Aufständischen und die Verräter sind an die Macht gekommen, dann ist die Lage klar. Und steht zu lesen, die Patrioten haben gesiegt, dann ist sie für uns auch klar — leider. Und auch die Reden Kennedys lesen wir. In den Antworten Chruschtschows. Wir haben die Spiegelschrift längst erlernt.“
Die berühmten Cafes „Louvre“ und „Continental“, wo Max Brod, Kafka, Werfel, Meyrink gesessen sind, gibt es nicht mehr,
wohl aber noch das ebenso bekannt gewesene Cafe Arco, das allerdings auf das Niveau eines Sportcafes herabgesunken ist. Ich stand davor und betrachtete die Fußballergebnisse, die hinter den Scheiben angeschlagen waren. Im Inneren sitzen auch hier die Herren still hinter ihren Zeitungsparavents, der Ober wechselt das Glas Wasser neben der Schale Gold, und man glaubt für ein paar Sekunden, die realen Verhältnisse der Umwelt seien nur ein böser Traum: nur die Geschichte eines Kafka oder Meyrink, die einst hier an diesen Tischen gesessen haben.
Man spricht deutsch, und das fast überall. Der Fremde kann jeden Herrn auf der Straße um Auskunft fragen, und mit freundlichem Lächeln erhält er Antwort. Fast immer wird man noch ein Stück des Weges nach dem gefragten Ziel begleitet, und wenn das Wort Wien fällt, geht ein Leuchten über das Gesicht des Begleiters. „Ja, ich war oft in Wien, ich habe dort einen Onkel, eine Kusine, einen Bruder“, sofort erfährt man verschiedenste Verwandtschaftsgrade. Nach wenigen Minuten erfolgt die höfliche Verbeugung, man stellt sich vor nach alter Manier, und dies tun auch jüngere Leute.
Natürlich heißen sie alle, wie die meisten guten Wiener, Cerny, Nowotny, Pospisil, Novak oder eben Kraus, Stein, Langer. Bei einem Fußballmatch Wien—Prag, so erzählt man mir, sei die Tschechoslowakei in arge Aufregung geraten, da in der Wiener Mannschaft lauter tschechische, in der tschechischen Mannschaft lauter deutsche Namen auftauchten und bei der Funkreportage ein Bild fürchterlicher nationaler Verwirrung entstand.
Überhaupt wird eine merkwürdige Beobachtung, die man in allen ehemaligen Ländern der Donaumonarchie machen kann, in Prag deutlich bestätigt: Der alte, von Wien aus regierte Nationalitätenstaat hat als Begriff und als Idealbild seit seinem Untergang eine unauslöschliche Lebendigkeit erhalten.
Von Preßburg, dem heutigen Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, erreicht man mit dem Auto in knapp eineinhalb Stunden den Wiener Stephansplatz, und man fuhr einst mit einer elektrischen Lokalbahn einander zum Abendessen besuchen. Heute blickt man von Preßburg auf die Grenzsperren, und es ist von dort näher nach Peking als in den Prater. In der ganzen Tschechoslowakei, die zwar ihren Humor, nicht aber ihren Witz verloren hat, kursiert ein treffendes Bonmot: In Preßburg wird auf einem politischen Schulungsabend ausführlich erklärt, wie bald es durch die überragenden Entdeckungen der Genossen Naturwissenschaftler in Moskau möglich sein werde, den Mond zu betreten. Beeindrucktes Schweigen in der Zuhörerschaft. Und dann fragt einer: „Und wann, Genosse Schulungsleiter, werden wir nach Wien fahren können?“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!