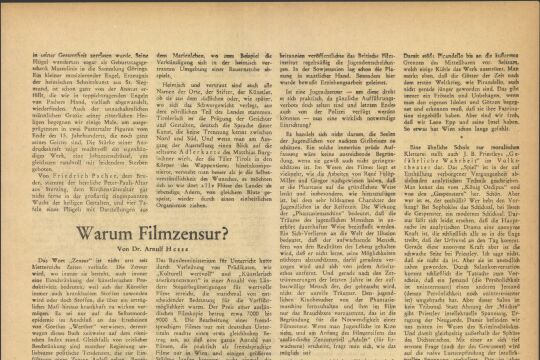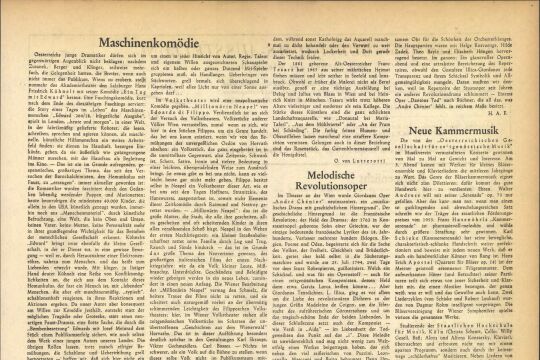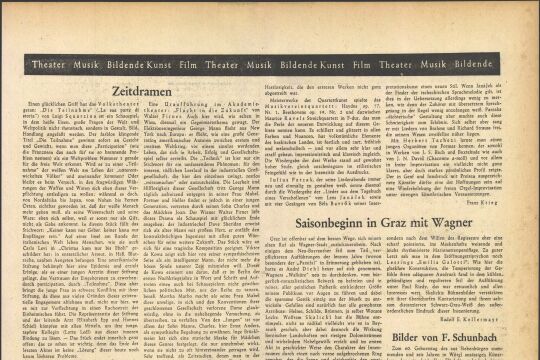Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
So ist das Leben nicht
Die Szene ist das Hinterzimmer in Harry Hopes, kleinem Hotel. Wenn sich der Vorhang hebt, sitzen sie da, dämmern, schlafen oder schwätzen: gescheiterte Existenzen, die der vertrunkene Harry aus Mitleid, vielleicht auch nur, um nicht allein zu sein, bei sich aufgenommen hat. Wenn der Vorhang nach dem vierten Akt von Eugene Gladstone O'N e i 11 s „Der Eismann kommt“ („The Iceman Cometh“) im Volkstheater sinkt, werden sie noch immer dort sitzen. Was sie aber auch tun, ob sie wachen oder schlafen, sie träumen. Sie träumen wie alle Menschen, die eine Vergangenheit haben, von morgen. Morgen werden sie sich aufraffen und neu anfangen, morgen werden sie ihre Angelegenheiten in Ordnung bringen und aufhören zu trinken, ganz bestimmt. Einmal heißt es, der Eismann solle kommen, aber es ist nur eine Bemerkung unter vielen. Der Eismann, das ist nicht der Weihnachtsmann, von dem man sich was erwartet, es ist nur der Mann, der das Eis für die Kühlschränke bringt. Aber der Eismann kommt nicht. Stattdessen kommt Theodore Hickman, den sie Hicky nennen. Hicky ist anders als sie, er kommt von draußen, auch wenn er oft mit ihnen trinkt. Aber nun trinkt Hicky nicht mehr. Und mit seinem Erscheinen wird das ewige „Morgen“ zum Heute. Er zwingt sie, die Realisierung ihrer Wünsche und Reden zu versuchen; sie tun es und scheitern. Hicky weiß, daß sie scheitern werden, aber er glaubt, daß das Ende der Illusionen, der Tod der Träume, ihnen das Glück bringen wird; er selbst hat seine Frau getötet, die an ihn glaubte, weil er von sich wußte, daß er nie ein anständiger Kerl werden würde, und ihren Glauben nicht ertragen konnte. Er hat die Polizei verständigt, und sie verhaftet ihn schließlich in Harrys „Nachtasyl“.
Eine dichte Atmosphäre ruht über dem ganzen Stück, das abwechselnd im Hinterzimmer oder vorne in der Bar spielt; die rauchige Luft ist zum Schneiden. Das Stück scheint aufs erste allen dramaturgischen Regeln zu widersprechen, besteht es doch nur aus Schnapsgesprächen. Was draußen passiert, wird hier nur erzählt, und es verändert sich seltsam in dieser dicken Atmosphäre. Doch O'Ncill vermag es, uns alles, was draußen geschieht oder geschehen ist, unwesentlich erscheinen zu lassen, und nur bedeutsam, wie es hier, im Hinterzimmer, aufgenommen wird. Er ist ein Dichter. Nur was hier vor sich geht, gilt. Aber hier geht nichts vor; alles dreht sich im Kreis, und nachdem Hicky ihnen allen, die ihr eigenes Versagen, ihre Unzulänglichkeit in diese Zuflucht trieb, ihren kümmerlichen Glauben nahm, spinnen sie sich neu ein in die Welt der Illusionen und des Rausches.
Die Aufführung unter der Regie Gustav Mankers hat das richtige Tempo, das die Spannung nicht abreißen läßt. Hans Putz zeichnet in Hicky eine Gestalt zwischen Taugenichts und leidendem Sucher nach Selbsterkenntnis. Theodor Grieg macht in Harry Hope den harmlos-gutmütigen Wirt, der bessere Tage kannte, lebendig. Otto Woegerer gibt Larry Slade, den Mann, der nicht mitmacht und der sein Mitleid für alle nicht töten kann; der aber von allem nicht loskommt, auch wenn er abseits ist. (In ihm scheint der Autor selbst unter seinen Figuren anwesend zu sein.) Kurt Sowinetz zeichnet in Don Parrit eine Judasfigur, deren Schicksal sich gleichzeitig mit dem Hickys erfüllt; er legt, von seiner Schuld überwältigt, selbst Hand an sich, nachdem Larry sein Urteil gesprochen hat. Larry aber sieht nur Fragen, keine Antworten. Doch stellt er die Fragen so, daß sie zu brennen beginnen und wir uns selbst aufgerufen fühlen, nach ihrer Antwort zu suchen.
Während Eugene O'Neill im Sonderabonnement des Volkstheaters, „Dichtung der Gegenwart“, gespielt wird, hat das V o I k s t h e a t e r für seinen Zyklus von Vorstellungen in den Außenbezirken Wiens die Komödie „Kolportage“ von Georg K a i s e r ausgewählt. Eine gute Wahl. Das Lustspielhafte an „Kolportage“ ermöglicht Peter Fürdauer, dem Regisseur, eine handfeste Persiflage auf einen Schundroman zu inszenieren; die Pointen kommen gut an und die Bühne hat alle Lacher für sich. „Kolportage, reine Kolportage“, heißt es an einer Stelle des Stückes, „ — aber so ist das Leben.“ Aber Kaiser weiß, daß das Leben auch eine andere Seite hat, und darum haben alle seine Stücke einen doppelten Boden. Die andere Seite, das ist die Liebe: wo sie auftritt, wird alles, was übertriebener Spaß schien, was köstliche Parodie und beißende Ironie war, auf einmal bitter ernst beim Wort genommen, und die kitschige „große Liebe“ wird zum einzig Wirklichen. Georg Kaiser hat zeitlebens eine Vorliebe für den Dienstmädchenglauben an Wunder gehabt. In ihnen nimmt seine Mystik (die in „Kolportage“ freilich nur ganz aus der Ferne spürbar wird) seinen Anfang; ihnen Wirklichkeit zu geben, war seine größte Lust. Und so wird auch diesmal die leichte Parodie zur echten Komödie. Es macht nichts, wenn diese Seite in der Aufführung, die für ein literarisch nicht vorgebildetes Publikum bestimmt ist, nur leise anklingt. Fürdauer hat aus der „Kolportage“ mit Hilfe eines ausgezeichneten Ensembles herausgeholt, was drin war. Genug für einen amüsanten Abend.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!