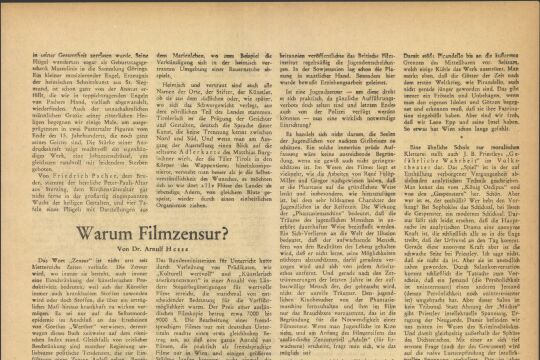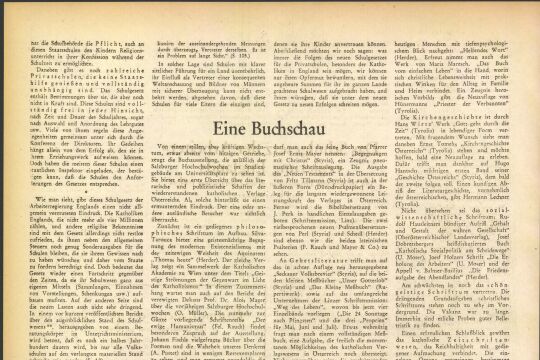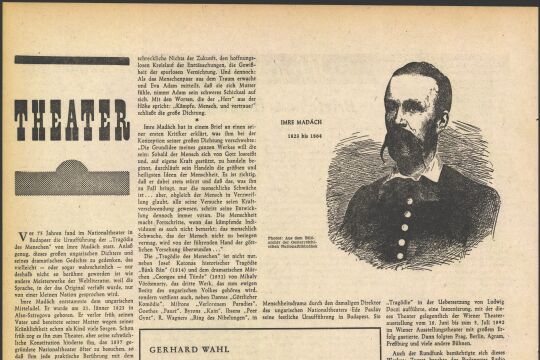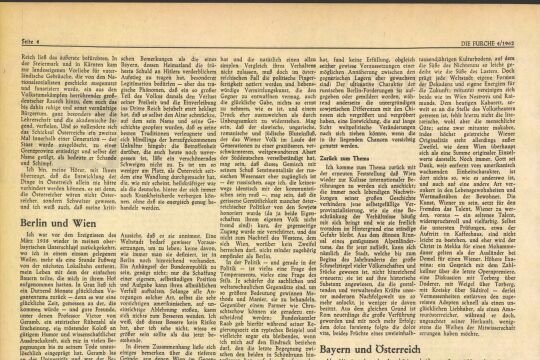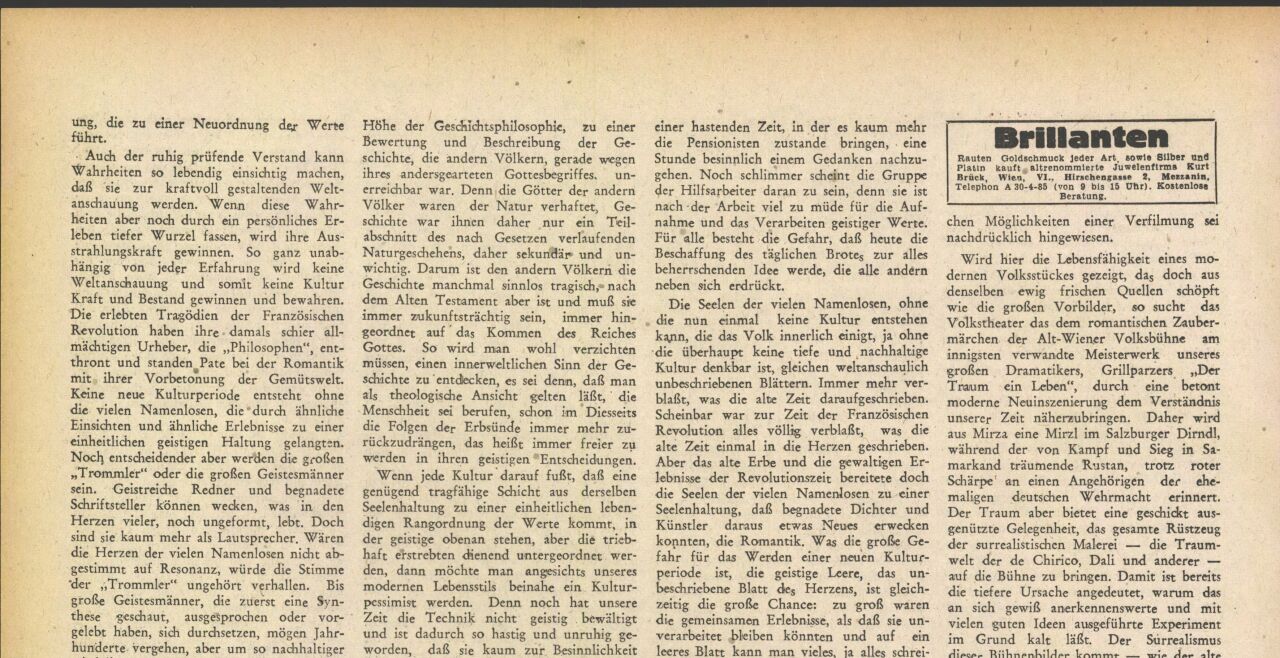
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Volkstümliches Theater
Die neue Spielzeit beginnt mit schwachbesuchten Vorstellungen. Die Auswirkungen der Teuerung und das langanhaltende Schönwetter mögen ihre Hand mit im Spiele haben sowie die verständliche Abneigung des Publikums gegen Problemstücke, die immer wieder eine ja schon unseren Alltag bedrückende Ruinenwelt auf die Bühne bringen. Die Theaterkonjunktur der Kriegsjahre und des ersten Nachkriegswinters scheint jedenfalls schon in eine fast ebenso sagenhafte Ferne gerückt wie jene Glanzzeit des Wiener Theaters im Vormärz, da Grillparzer und Hebbel, Halm und Bauernfeld, Raimund und Nestroy in einer Stadt wirkten, in der es zwar keine politischen Zeitungen, dafür aber um so mehr Theaterzeitungen gab, die das rege Interesse der Wiener an allen Ereignissen der Bühnenwelt wachhielten.
Ist die Überlieferung des Wiener Volkstheaters heute endgültig tot oder führt sie doch noch ein durch ungünstige Zeitumstände nur vorübergehend überschattetes Leben? Wer Gelegenheit hatte, in den Gefangenenlagern dieses Krieges die unverwüstliche Spielfreude der Wiener und die erstaunliche Fülle der hier vorhandenen Begabungen kennenzulernen, der hat die tröstliche Gewißheit gewonnen, daß das Theater dem Wiener auch heute noch im Blute liegt. Daher verdienen alle jene Bemühungen besondere Aufmerksamkeit, die die Uberlieferung des Wiener Volkstheaters in lebensvoller Weise fortzuführen suchen — womit weder eine epigonenhaft-unfrudit-bare „Traditionswahrung“, noch jene geschmacklos-kitschige „Modernisierung“ gemeint ist, die uns in Operettenfilm und Revueoperettc bis zum Überdruß vorgesetzt wurde und auch heute wieder vorgesetzt wird.
Die breite Grundlage des Wiener Theaterlebens im Vormärz war das Vorstadttheater und so geht man auch heute wohl am besten hinaus in den 15. Bezirk, wo das „Theater der Stephansspieler“ mit dem Schauspiel von Rudolf Körner „Seil zwischen Wolken“ die mit dem „Unheiligen Haus“ erfolgreich aufgenommene Linie des modernen Volksstückes fortsetzt. Die einfache Moral — daß auch in der Welt der Technik, bei einer Seilbahn das Gefühl neben dem Verstand sein Recht hat — wird von der liebenswerten Gestalt des alten Seilbahnführers Pfandl in einer an Anzengruber erinnernden kernigen Schlichtheit in Wort und Tat vertreten. Es ist gutes, handfestes Theater, von einer erfreulich geschlossenen schauspielerischen Leistung in einem einfachen und ansprechenden Bühnenbild sauber und herzerfrischend geboten. Man ist wirklich auf den Ausgang gespannt — vielleicht auch deshalb, weil der Autor anscheinend bis zum Schluß selbst nicht ganz sicher war, für welche der verschiedenen möglichen Lösungen er sich entscheiden sollte — weshalb er wohl -schließlich auch eine eigentümliche Mischung von Happy-End und tragischem Ausgang wählte. Trotz manchen Schwächen befolgt so das Schauspiel selbst die vom alten Pfandl gepredigte Lehre von der soliden Arbeit und der notwendigen Verbindung von Technik und Gefühl. Auf die in dem Stück enthaltenen reichen Möglichkeiten einer Verfilmung sei nachdrücklich hingewiesen.
Wird hier die Lebensfähigkeit eines modernen Volksstückes gezeigt, das doch aus denselben ewig frischen Quellen schöpft wie die großen Vorbilder, so sucht das Volkstheater das dem romantischen Zaubermärchen der Alt-Wiener Volksbühne am innigsten verwandte Meisterwerk unseres großen Dramatikers, Grillparzers „Der Traum ein Leben“, durch eine betont moderne Neuinszenierung dem Verständnis unserer Zeit näherzubringen. Daher wird aus Mirza eine Mirzl im Salzburger Dirndl, während der von Kampf und Sieg in Sa-markand träumende Rustan, trotz roter Schärpe an einen Angehörigen der ehemaligen deutschen Wehrmacht erinnert. Der Traum aber bietet eine geschickt ausgenützte Gelegenheit, das gesamte Rüstzeug der surrealistischen Malerei — die Traumwelt der de Chirico, Dali und anderer — auf die Bühne zu bringen. Damit ist bereits die tiefere Ursache angedeutet, warum das an sich gewiß anerkennenswerte und mit vielen guten Ideen ausgeführte Experiment im Grund kalt läßt. Der Surrealismus dieser Bühnenbilder kommt — wie der alte Pfandl sagen würde — aus dem Kopf und nicht aus dem Herzen, auch nicht aus einer überschäumenden Phantasie, ist oft gesucht originell und konstruiert, aber nicht wirklich ursprünglich. Besorgt fragt man sich zudem, ob die Kunst, edle Verse zu sprechen, in der jüngeren Wiener Schauspielergeneration allmählich verlorengeht.
Auch in dem neuen Gewand aber offenbart sich wieder die unvergängliche Schönheit dieses „dramatischen Märchens“, das aus der Verbindung der Zauberwelt des Alt-Wiener Volkstheaters mit dem Vorbild Calderons, aus romantischen und klassischen Elementen und der Zeitmode des „Besserungsstückes“ zu harmonischer Einheit erwachsen ist. Die tiefe, manche Einsicht der modernen Psychologie intuitiv vorwegnehmende Erkenntnis von den in der Menschenbrust schlummernden dunklen Versuchungen wird erlösend geläutert zur schlichten Altersweisheit des österreichischen Biedermeiers von der Gefahr der Größe, von der Notwendigkeit des Verzichts und vom Glück der stillen Zufriedenheit. Dankbar erlebt man wieder die Zauberkraft eines echten Kunstwerks, das — edelste Frucht des Wiener Volkstheaters — ' mit seiner überzeitlichen Symbolik seelische Wunden lindert und heilt und daher gerade unserer Zeit wieder viel zu sagen hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!