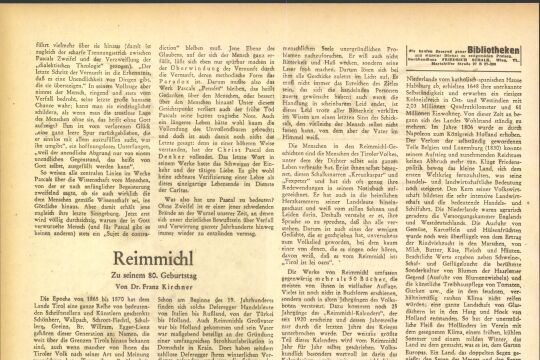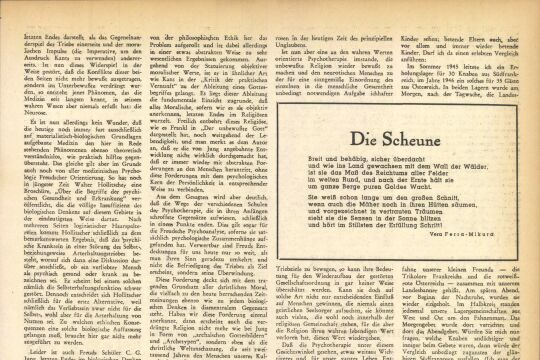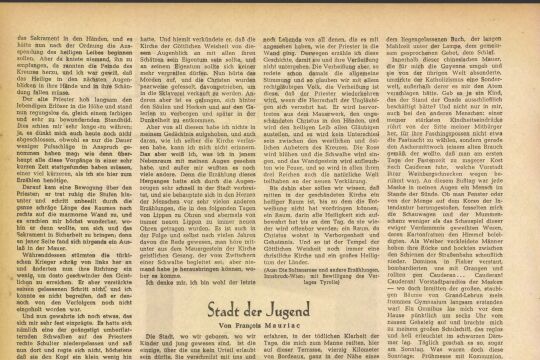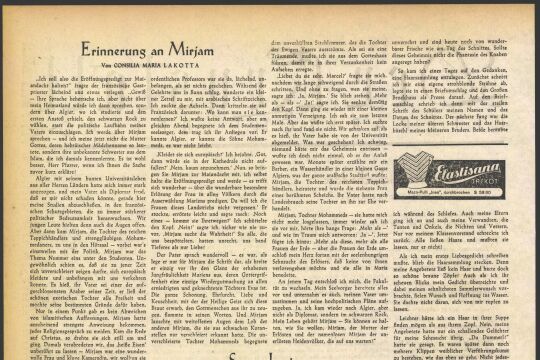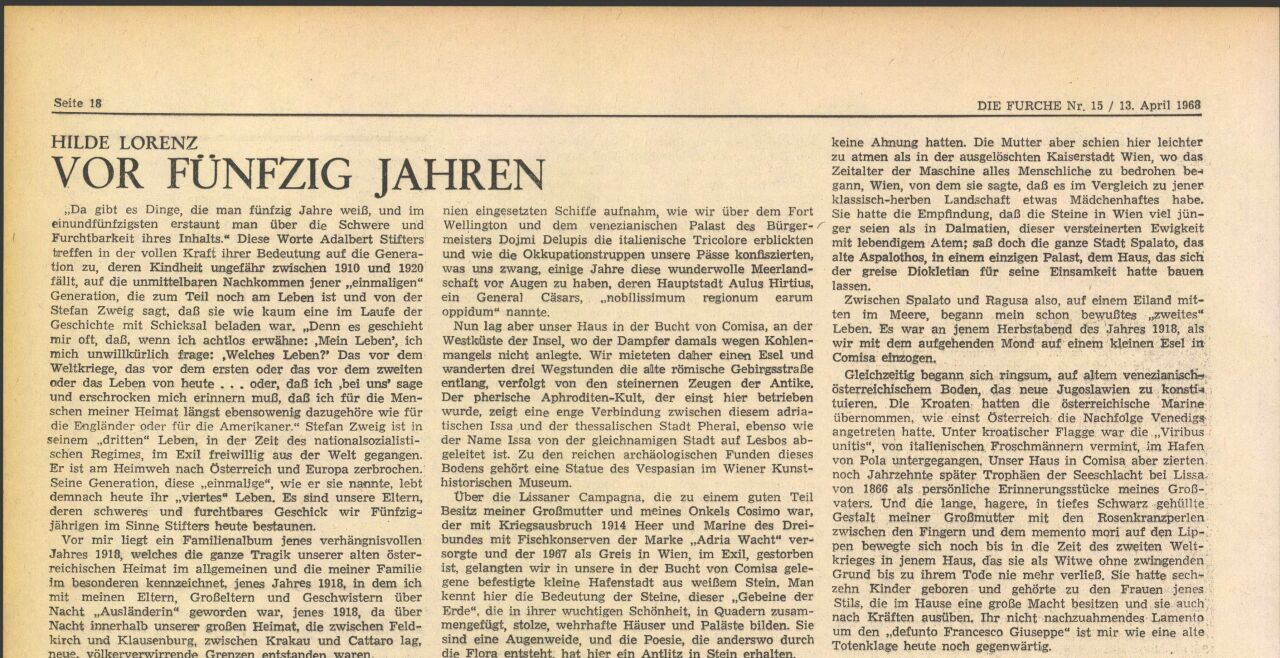
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
VOR FÜNFZIG JAHREN
„Da gibt es Dinge, die man fünfzig Jahre weiß, und im einundfünfzigsten erstaunt man über die Schwere und Furchtbarkeit ihres Inhalts.” Diese Worte Adalbert Stifters treffen in der vollen Kraft ihrer Bedeutung auf die Generation zu, deren Kindheit ungefähr zwischen 1910 und 1920 fällt, auf die unmittelbaren Nachkommen jener „einmaligen” Generation, die zum Teil noch am Leben ist und von der Stefan Zweig sagt, daß sie wie kaum eine im Laufe der Geschichte mit Schicksal beladen war. „Denn es geschieht mir oft, daß, wenn ich achtlos erwähne: .Mein Leben’, ich mich unwillkürlich frage: .Welches Leben?’ Das vor dem Weltkriege, das vor dem ersten oder das vor dem zweiten oder das Leben von heute . . . oder, daß ich .bei uns’ sage und erschrocken mich erinnern muß, daß ich für die Menschen meiner Heimat längst ebensowenig dazugehöre wie für die Engländer oder für die Amerikaner.” Stefan Zweig ist in seinem „dritten” Leben, in der Zeit des nationalsozialistischen Regimes, im Exil freiwillig aus der Welt gegangen. Er ist am Heimweh nach Österreich und Europa zerbrochen. Seine Generation, diese „einmalige”, wie er sie nannte, lebt demnach heute ihr „viertes” Leben. Es sind unsere Eltern, deren schweres und furchtbares Geschick wir Fünfzig jährigen im Sinne Stifters heute bestaunen.
Vor mir liegt ein Familienalbum jenes verhängnisvollen Jahres 1918, welches die ganze Tragik unserer alten österreichischen Heimat im allgemeinen und die meiner Familie im besonderen kennzeichnet, jenes Jahres 1918, in dem ich mit meinen Eltern, Großeltern und Geschwistern über Nacht „Ausländerin” geworden war, jenes 1918, da über Nacht innerhalb unserer großen Heimat, die zwischen Feldkirch und Klausenburg, zwischen Krakau und Cattaro lag, neue, völkerverwirrende Grenzen entstanden waren.
Die erste Seite des Albums zeigt ein geradezu legendäres Bild meiner Mutter mit uns Kindern, aus den Tagen, als sie nach dem Verlust ihres Mannes von Wien in ihre süddalmatinische Heimat zurückkehrte. Sie nannte Wien das fremde, weil ihr persönliches Geschick sie diese Stadt als eine bevölkerte Einsamkeit empfinden ließ, wenngleich es im alten Vielvölkerstaat im allgemeinen kein Problem war, Österreicher deutscher oder slawischer oder italienischer Nation zu sein. Man klagte viel über die soziale Armut Dalmatiens, aber wer dieses Dalmatien kannte, mochte in diesem gesegneten Land das wiederfinden, was Friedrich Sieburg an Frankreich rühmt: „Ich wage nicht zu entscheiden, was besser ist, ein vollkommenes System der sozialen Fürsorge oder ein unerschöpflicher Vorrat an Weißbrot und Rotwein.” Schon Agatharchides aus Knidos sagte: „Auf der Adriainsel Issa wächst der beste Wein der Welt”; und man vergesse nicht den Reichtum des Meeres; denn während anderswo die menschlichen Sinne langsam verkümmerten, briet man hier in den Rauchküchen die Speisen der „Armen”, etwa in Mehl und purem Olivenöl getränkte Sardellen, auf offener Glut, auf Feuer ganz bestimmter Hölzer. Auch unterschied das Inselvolk sehr wohl die zur Zubereitung nötigen köstlichen heimischen Kräuter und Gewürze. Wer konnte sich noch der Seligkeit solchen Geschmacks rühmen, wer des Vorhandenseins der gravitätisch schreitenden Wasserträger, wer des Gebrauchs von Öllampen, wer der Schicksalsgemeinschaft ganzer Gemeinden von der Tauffeier bis zur TotenMage!
Ich kann das Bild meiner Mutter nicht aus den Augen lassen: eine frierende Pflanze, die ein vorbeiziehender Schatten schon frösteln macht; die schmalen, langen Lippen, der auf mich gerichtete Blick voll Liebe und Leid. Jene Stunde wird Gegenwart . . . Tiefe, schwarze, melancholische Augen drücken Verzicht aus in einer Weise, als wären ihr durch das Geschick von Anfang an alle Wünsche versagt worden. Ein schmerzvolle Grazie beherrscht das ganze Portrait: das schwarze Kleid steht in seltsamer Harmonie zu den leeren, schmucklosen Händen, die von ausgeschüttetem Vorrat sprechen; denn in der Tat hatte sie ihre letzten Pretiosen gegeben, um die Rückkehr in die Heimat, diesen „österreichischen” Weg, den damals Millionen gingen, zu ermöglichen. In der Not jener Tage gehorchte sie mit starkem Herzen einem Lebenssinn, der ihr befahl, wieder glücklich zu werden und einer ruinierten Welt, die nur Macht anstrebte und Größe nachäffte, zu entfliehen.
Beim Anblick dieses Bildes erlebe ich das Aufdämmern meiner Kindheit, sehe mit geschlossenen Augen, wie unser Schiff in den Hafen von Lissa einfuhr. der einst triumphierend die Panzer- und Holzfregatten Tegetthoffs und viel früher die von den Römern gegen Philipp V. von Makedonien eingesetzten Schiffe aufnahm, wie wir über dem Fort Wellington und dem venezianischen Palast des Bürger- r meisters Dojmi Delupis die italienische Tricolore erblickten und wie die Okkupationstruppen unsere Pässe konfiszierten, was uns zwang, einige Jahre diese wunderwolle Meerlandschaft vor Augen zu haben, deren Hauptstadt Aulus Hirtius, ein General Cäsars, „nobilissimum regionum earum oppidum” nannte.
Nun lag aber unser Haus in der Bucht von Comisa, an der Westküste der Insel, wo der Dampfer damals wegen Kohlen- mangeds nicht anlegte. Wir mieteten daher einen Esel und wanderten drei Wegstunden die alte römische Gebirgsstraße entlang, verfolgt von den steinernen Zeugen der Antike. Der pherische Aphroditen-Kult, der einst hier betrieben wurde, zeigt eine enge Verbindung zwischen diesem adriatischen Issa und der thessalischen Stadt Pherai, ebenso wie der Name Issa von der gleichnamigen Stadt auf Lesbos abgeleitet ist. Zu den reichen archäologischen Funden dieses Bodens gehört eine Statue des Vespasian im Wiener Kunsthistorischen Museum.
Über die Lissaner Campagna, die zu einem guten Teil Besitz meiner Großmutter und meines Onkels Cosimo war, der mit Kriegsausbruch 1914 Heer und Marine des Dreibundes mit Fischkonserven der Marke „Adria Wacht” versorgte und der 1967 als Greis in Wien, im Exil, gestorben ist, gelangten wir in unsere in der Bucht von Comisa gelegene befestigte kleine Hafenstadt aus weißem Stein. Man kennt hier die Bedeutung der Steine, dieser „Gebeine der Erde”, die in ihrer wuchtigen Schönheit, in Quadern zusammengefügt, stolze, wehrhafte Häuser und Paläste bilden. Sie sind eine Augenweide, und die Poesie, die anderswo durch die Flora entsteht, hat hier ein Antlitz in Stein erhalten.
Der geduldige kleine Vierbeiner trug unsere geretteten Habseligkeiten und nahm zusätzlich uns Kinder abwechselnd auf seinen schmalen Rücken. „Hast du schon oft eine große Reise gemacht?” fragten wir unsere Mutter. Und sie sagte: „Die letzte schrecklich große Reise machten wir zusammen vor drei Jahren, 1915, von Monfalcone nach Wien … es war die Flucht aus der Hölle am Isonzo . . . eines von Euch lag noch in Windeln . .Auf geschwächten Füßen und früh schon gesundheitlich erschüttert, führte sie uns nun durch die von ihrer Vergangenheit getränkten, ewig süß, aber zugleich auch traurig duftenden Weinberge, vorbei an müßigen, anmutigen Ziegenhirten und Guslaren, die, in zottige Kutten gehüllt, unter Feigen- und Johannesbrotbäumen Kühlung suchten und von einer Welt außerhalb der ihren
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!