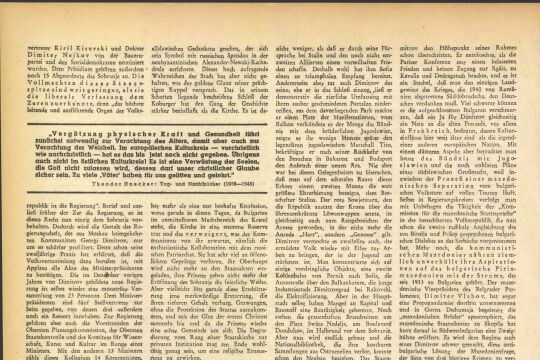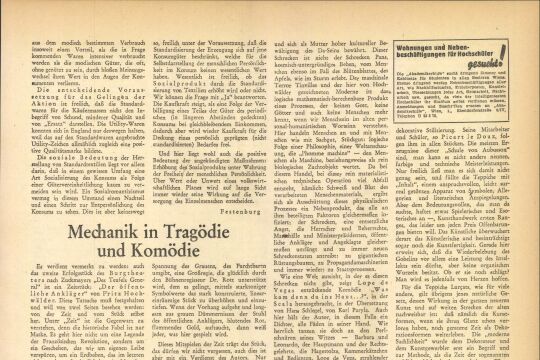Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wiener Theater beginnen
Das Voikstheat r eröffnet die neue Spielzeit der Wiener Theater mit Hermann Bahrs „Q u e r u 1 a n t“. „Eine Komödie.“ Eine Komödie? Bahr setzt dieser Geschichte vom „Hios“, dem Keuschler, der ob seines vom Förster „ermordeten" Hundes mit aller Welt Feind und darob, am Ende der Geschichte, fast selbst zum Mörder — an einem Menschen — wird, starke Akzente des Tragischen auf, die in der ausgezeichneten Darstellung des Volkstheaters noch unterstrichen werden. Und •r belädt sein Stück mit zahlreichen Reflexionen über irdische und himmlische Gerechtigkeit, über das Recht Gottes und jenes andere der menschlichen Gericht . Da klingen nun einige Sätze auf, die an Tiefere rühren: an erlebte, in personaler Erfahrung verifizierte Welt-Anschauung. Dennoch machen diese nicht das Beste, das Wertvollste des Stückes aus — dieses hat seinen Kern in jener als „Tierliebe“ verkleideten franziskanischen Humilität, in jener Herztiefen Zu-Neigung zu dem „Tier“ als Fleischgestalt des Niedrigen, Kleinen, des Krea- türlichen schlechthin. Ein Offensein dem Pulsschlag der Schwäche, der leid-stummen Geschöpf lieh keit, das als ein Kennzeichen österreichischer Humanität angesprochen werden muß. Es würde sich lohnen, dieser Tiersymbolik in der österreichischen Dichtung nachzugehen — so verschiedenartige Persönlichkeiten, wie Ferdinand von Saar und Felix Salten, die Eschenbach und unser Bahr schaffen hier mit an einer Symphonie. Das Tier als „Held"? Nein, als ein Mahnmal der Milde, der Menschlichkeit, dem Menschen vor-gestellt, der sich selbst Feind ist. Solange nun Bahrs „Querulant", auf den Hund gekommen, beim Hund bleibt, ist alles gut. Bedenklich abfallend die letzten Akte, die nicht frei sind von Ganghoferscher Förstermaidromantik, von Allerweltsphrasen, von billigen Klischeefiguren. — Die Schauspieler bemühen sich herzhaft, den Schwung der beiden ersten Akte zu retten, wa9 nicht ganz gelingt, nicht gelingen kann. Trotz diesem Absinken: eine Aufführung, die manche liebenswerte Züge des großen Österreichers aufzeiigt und präsent macht.
„Deutschland, wir weben dein Leichentuch, wir weben hinein einen dreifachen Fluch, wir weben, wir weben..Seit Heine sein Weberlied sang, ist das Schicksal der schlesischen Weber in der Epoche de9 deutschen Frühkapitalismus, eine der größten sozialen Katastrophen der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts, Literatur. Ist Literatur bereits lange, bevor der junge Hauptmann, ringend mit den Ideen des Sozialismus, des Christentums, mit dem Mystizismus seines schlesischen Gemüts, auf diesen „Stoff“ verfällt. Dies will bedacht werden, wenn wir heute seinen „Webern“ gerecht wenden wollen. Hauptmann befreit den Stoff vom Papier — vom Papier der Gazetten, der Phraseologien, der parteigebundenen Programme und Parolen — und löst aus dem Material der Politiker die Materie des Dichters; die Tragödie des notleidenden Menschen. Ein soziales Drama — gewiß, wie im Grunde jedes Drama, das nicht in der Brust eines einzelnen beschlossen ist. Das Versagen einer Gesellschaft, die noch gar kein Auge hat, um zu sehen, bis in welche Dimensionen hinein sie sich selbst in Frage stellt in der mitverschuldeten Verelendung dieser Massen. Deren Ohr durch die „aufrührerischen“ Lieder der Weher beleidigt, nicht aber geöffnet wird. Der junge Gerhart Haupt- mann sieht das alles und hat auch den Mut, es zu sagen, auszusagen. Der reiche Fabrikant, der saturierte und domestizierte Pastor, die Polizei- und Staatsgewalt „interessieren“ ihn, er braucht ihre Gestalten als burlesk-bizarr-böse Figurinen. Bewegt, ergriffen wird er nur durch eines — durch das ausweglose Leid seines Webervolkes. Dieses Leid tropft wie ein steter nie aussetzender Regen, durch alle schlechtverklemmten Fugen der Weberbuden, nistet im Barchent, im Staub des Garns, im Webstuhl, in den Lungen und Leibern der Weber.
„Wir sind arm, das ist wahr" — Luthers lezte Worte haben im Leben dieser Menschen eine grauenhafte Säkularisierung und Realisierung gefunden, die das Existenzminimum angreift und zerstört. Jenes Mindestmaß, das nötig ist, um als Mensch, um als Christ leben zu können. Der alte Weber, der allein noch, unerschütterlicher Träger glauhensmäßiger Substanz, die Fahne des anderen, des jenseitigen Reiches hochhält, fällt unter den Kugeln des Militärs.
Hauptmanns mitleidstarkes Sichversinken in das immerwährende Leid seiner Weber macht die innere Kraft und äußere Schwäche dieses seines Stückes aus. Die Monotonie dieses Leidregens ermüdet. Die schlesische Mundart, versetzt mit sächsischen und Wiener Elementen — in der Aufführung der Scala, die mit diesem Stück eröffnet, erhöht die Anstrengung, ganz durchzuhalten. Die Regie Haenels bemüht sich sichtlich, Hauptmann zu gehen, was Hauptmann ist — in einer sorgfältigen Ausmalung des Details, so daß der Pulsschlag des Ganzen manchmal ins Stocken kommt. Das Publikum aber hält durch.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!