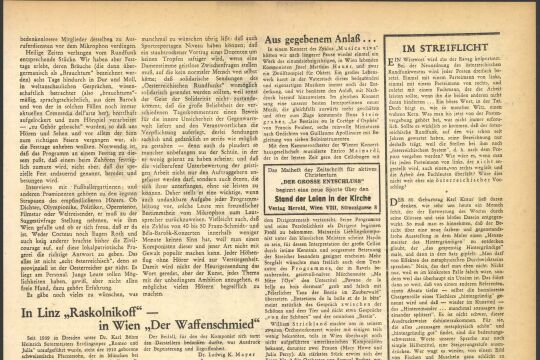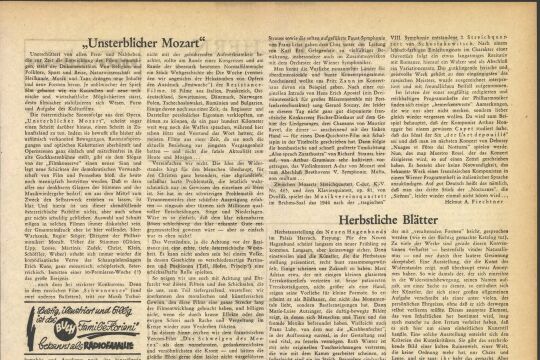Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zerredet
In letzter Zeit sind bei uns überraschend viele Filme angelaufen, die sich — mehr oder weniger intensiv mit Rassenproblemen befassen. So zum Beispiel der ausgezeichnete Kriminalfilm „In der Hitze der Nacht” und der englische Rassenproblemfilm aus dem Schulmilieu „Herausgefordert”, der allerdings das in der Drehbuch Vorlage enthaltene Problem der Heirat eines Negers mit einer Weißen völlig ausklammert. Dafür beschäftigt sich der amerikanische Film „Rat mal, wer zum Essen kommt?”, der von Stanley Kramer inszeniert wurde, um so intensiver mit dieser Frage. So wie die Deutschen vor einiger Zeit immer wieder ihre unbewältigte Vergangenheit — vergeblich — zu bewältigen versuchten, so kämpfen die Amerikaner nun mit ihrer seit langer Zeit unbewältigten Gegenwart. Und sie konstruieren sich mit diesem Film einen Modellfall, der nicht nur das Rassenprobtem nach allen Regeln der Kunst abhandeln soll, sondern gleichzeitig auch beweisen muß, wie ungeheuer aufgeschlossen, tolerant und einsichtig der Amerikaner im Grunde doch ist. Man könnte meinen, der Film sei nach einem Theaterstück gedreht, denn abgesehen davon, daß sich das Geschehen schon rein formal in einer fast nahtlosen Einheit von Zeit, Ort und Handlung abspielt, wird das Hauptthema fast pausenlos besprochen, beredet — zerredet… Man muß dem Streifen dennoch konzedieren, daß er wirklich versucht, sein Problem von allen Seiten zu beleuchten und mit größtmöglicher Objektivität zu lösen. Aber der ganze Fall ist mit soviel Raffinesse konstruiert, daß dem Durchschnittsamerikaner, auch bei noch so viel Selbstkritik, nicht ernstlich wehgetan wird. Und darin liegt die versteckte — und gefährliche — Tendenz des Filmes: Das Paar, um das es hier geht, um das hier so viele und so große Worte gemacht werden, wird mit den eigentlichen Problemen einer Rassenmischehe gar nicht richtig konfrontiert werden, es geht ja ohnehin nach Europa, später nach Afrika. Und dieser Sonder.
Das Wiener Lied, jenes gefühlsbetonte Musikprodukt an der Grenze von echter Volkstümlichkeit und bewußt gelenkter Rührseligkeit, das zumeist aus Heurigen- oder Buschenschanken seinen Weg in die Welt nimmt, hat seine Meriten und einen entsprechend großen Kreis von Interessenten. Und wenn wir den Angaben der reizenden Eva- maria Klinger vom Postfach „7000” folgen, dann ist die Nachfrage der Fernseher, speziell auch der ausländischen, noch größer als das Angebot dieser speziellen Sparte. Wobei wir ganz außer acht lassen wollen, daß das Verlangen nach ihm aus jener oft bekrittelten und typisch wienerischen Dulliöh-Stimmung entspringt. Bisher konfrontierte uns Heinz Conrads in seiner samstägigen Plauderei mit vergangenen und jüngsten Erzeugnissen dieses musikalischen Genres. Übrigens hätte der Regisseur dieser Sendung am letzten Wochenende die aufdring- lich-betunliche Mimik der Interpretinnen — Vater Striese hätte vielleicht an ihnen seine helle Freude gehabt — ruhig etwas dämpfen können. Nun hat sich auch noch Fritz Muliar, assistiert von den Drei Spitzbuben, ebenfalls des Wiener Liedes angenommen und recht interessante Betrachtungen mehr sozialkritischer Art darüber angestellt. Trotzdem erscheint es uns des Guten zuviel, wenn man sich in so kurzen Abständen mit diesem wenn auch noch so populären Thema beschäftigt. Die Gefahr der Überfütterung und Abnutzung bleibt da die gleiche wie im Fall des von uns so überaus geschätzten Dr. Marcel Prawy.
Zu einem wirklichen Bildschirmgewinn verdichtete sich nun die zum vierten Male ausgestrahlte Folge „Die heiße Viertelstunde” mit Topsy Küppers und Georg Kreisler, bei der einem die beiden Künstler mit ihren makabren Chansons über die heutige Wohlstandsgesellschaft temperamentvoll im wahrsten Sinne des Wortes einkreisen. Eine Sendung von internationalem Format. Spannung und Unterhaltung, wenn auch mehr für die jüngeren Jahrgänge — wobei auch so manche ältere in Erinnerung an die eigene Jugend mitschwelgen —, bot der vierte und letzte Teil des zu einem Fernsehfilm gestalteten Romans „Die Schatzinsel” nach R. L. Stevenson. Wenn es eines Beweises bedurft hätte, daß die Familie Hörbiger-Wessely wirklich eine Gemeinschaft von Vollblutkomödianten ist/ dann hätte ihn die Aufführung des Stückes „Fast ein Poet” — mit Attila Hörbiger, Paula Wessely und Tochter Elisabeth Orth — in packender und überzeugender Deutlichkeit geliefert.
Die konstruierte Notwendigkeit einer Improvisation blieb fast der einzige Einfall zu der musikalischen Komödie „Paradies auf Erde n” von Paul Sörensen, zu dem John B. Priestley mit seinem Stück „Seit Adam und Eva” Pate stand. Klaus Peter Wittes Regie gab vor allem Hanne Wieder und Karl Schönböck Gelegenheit, sich in mehrfachen und drastischen Verwandlungen ganz attraktiv zu präsentieren, wobei die Jugend und Spielfreudigkeit von Grit Böttcher und Hans Michael Rehberg sie wirkungsvoll unterstützten. JEK.
fall eines sympathischen Negers — übrigens, wie auch in den beiden eingangs erwähnten Filmen, gespielt von dem großartigen Sidney Poitier, dürfte auch nicht Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Positiv ist es dem Film anzurechnen, daß er seine Probleme keineswegs auf die leichte Schulter nimmt, beide Seiten zu Wort kommen läßt, und vor überstürzten Entscheidungen eindringlich warnt. Aber um wie vieles eindringlicher wäre diese Mahnung noch geraten, wenn man auf das zuckerlrosa Happy-End verzichtet und den Augang offengelassen hätte. Überhaupt ist der ganze Film inszenatorisch im Stile der großen Hollywoodkomödien früherer Jahre gehalten, was unbedingt einen Stilbruch in Hinblick auf das ernste Thema darstellt. Erträglich wird das Ganze letzten Endes nur durch die durch Spencer Tracy (t) und Katherine Hepburn, die hier zum letzten Male eines ihrer berühmten Filmehepaare spielen, sowie durch Sidney Poitier und die vielversprechende Katherine Houghton.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!