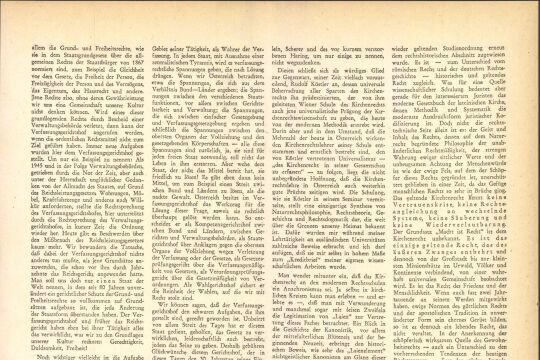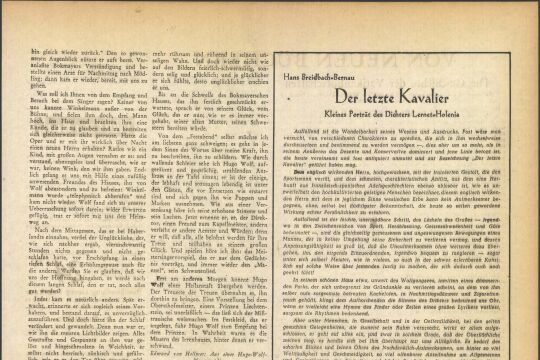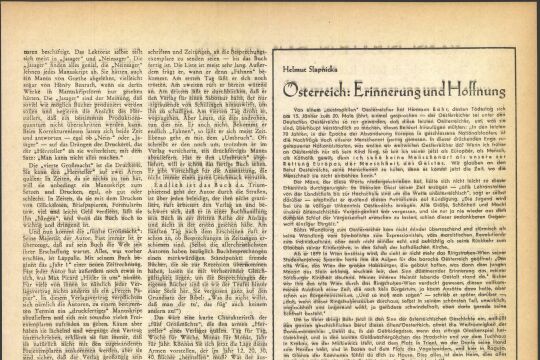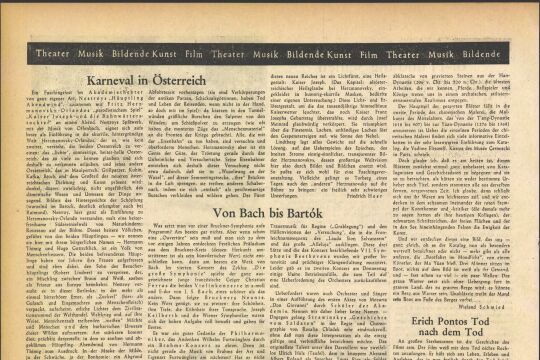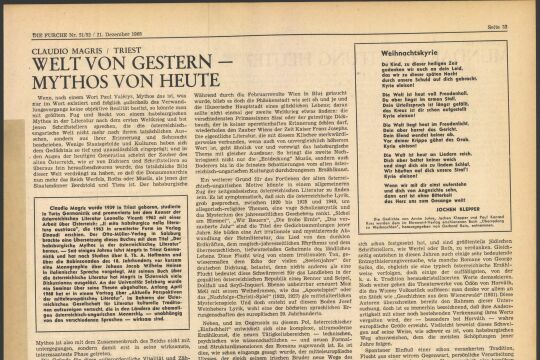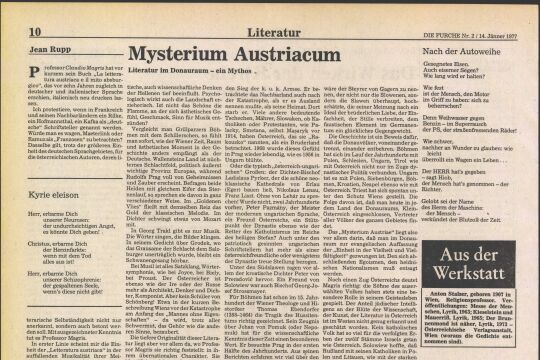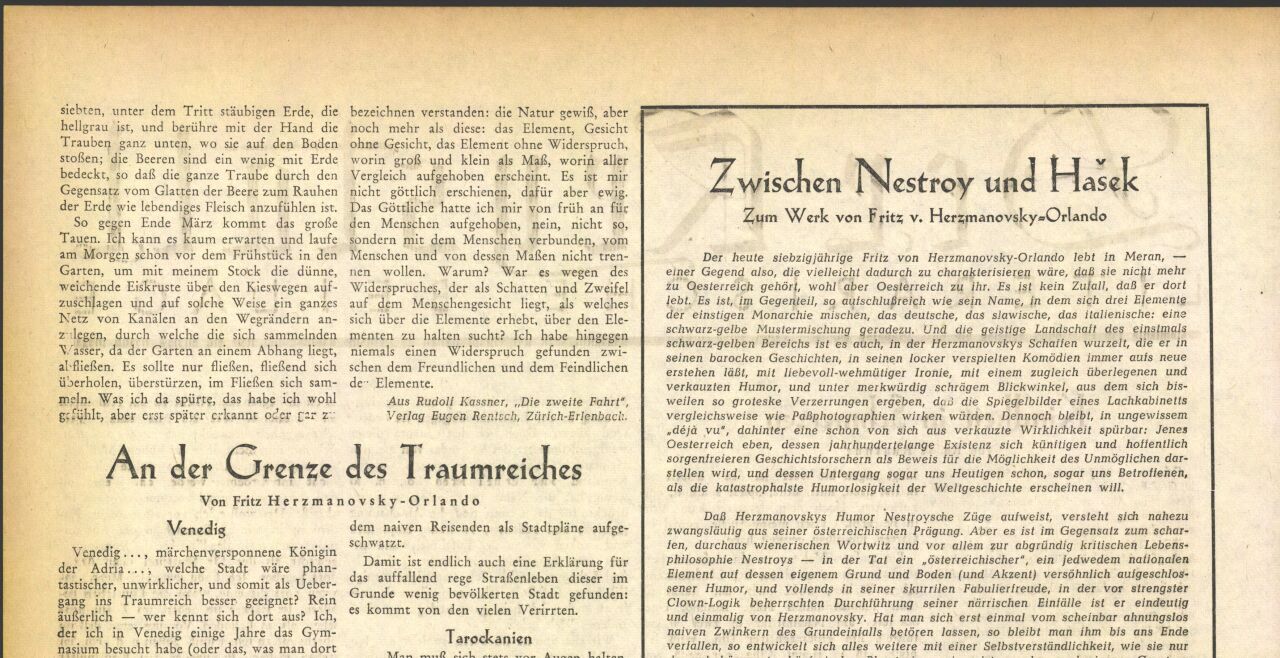
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Zwischen Nestroy und Hasek
Der heute siebzigjährige Fritz von Herzmanovsky-Orlando lebt in Meran, —• einer Gegend also, die vielleicht dadurch zu charakterisieren wäre, daß sie nicht mehr zu Oesterreich gehört, wohl aber Oesterreich zu ihr. Es ist kein Zulall, daß er dort lebt. Es ist, im Gegenteil, so aufschlußreich wie sein Name, in dem sich drei Elemente der einstigen Monarchie mischen, das deutsche, das slawische, das italienische: eine schwarz-gelbe Mustermischung geradezu. Und die geistige Landschatt des einstmals schwarz-gelben Bereichs ist es auch, in der Herzmanovskys Schallen wurzelt, die er in seinen barocken Geschichten, in seinen locker verspielten Komödien immer auis neue erstehen läßt, mit liebevoll-wehmütiger Ironie, mit einem zugleich überlegenen und verkauzten Humor, und unter merkwürdig schrägem Blickwinkel, aus dem sich bisweilen so groteske Verzerrungen ergeben, dal die Spiegelbilder eines Lachkabinetts vergleichsweise wie Paßphotographien wirken würden. Dennoch bleibt, in ungewissem „dejä vu“, dahinter eine schon von sich aus verkauzte Wirklichkeit spürbar: Jenes Oesterreich eben, dessen jahrhundertelange Existenz sich künftigen und hoilentlich sorgenfreieren Geschichtsforschern als Beweis für die Möglichkeit des Unmöglichen darstellen wird, und dessen Untergang sogar uns Heutigen schon, sogar uns Betroffenen, als die katastrophalste Humorlosigkeit der Weltgeschichte erscheinen will.
Daß Herzmanovskys Humor Nestroysche Züge aufweist, versteht sich nahezu zwangsläufig aus seiner österreichischen Prägung. Aber es ist im Gegensatz zum scharfen, durchaus wienerischen Wortwitz und vor allem zur abgründig kritischen Lebensphilosophie Nestroys — in der Tat ein „österreichischer“, ein jedwedem nationalen Element auf dessen eigenem Grund und Boden (und Akzent) versöhnlich aulgeschlossener Humor, und vollends in seiner skurrilen Fabulierfreude, in der vor strengster Clown-Logik beherrschten Durchführung seiner närrischen Einfälle ist er eindeutig und einmalig von Herzmanovsky. Hat man sich erst einmal vom scheinbar ahnungslos naiven Zwinkern des Grundeinfalls betören lassen, so bleibt man ihm bis ans Ende verfallen, so entwickelt sich alles weitere mit einer Selbstverständlichkeit, wie sie nur der unbekümmert schöpferischen Phantasie zu eigen ist, nur dem nach eigenen Gesetzen angetretenen Original, das sich ganz auf die Bildfülle und Ueberzeugungskraft seiner Visionen verläßt.
Herzmanovskys noch im Manuskript befindliches Hauptwerk, das „Maskenspiel der Genien“, eine groß und mystisch angelegte Trilogie über Oesterreichs europäische Sendung, spielt in einem irgendwo zwischen Venedig, Krain und Kroatien gelegenen Traumstaat, der nach dem klassischen Kartenspiel der einstigen Monarchie „Tarockanien“ heißt (und, nebenbei, beträchtlich vor Robert Musils „Kakanien“ konzipiert wurde). Dort feiern Polizei, Behörden, Aerar, kurzum die gesamte Bürokratie wahre Orgien an Selbstbestätigung — und Selbstentlarvung. Aber Herzmanovsky macht es sich nicht so einfach wie die dürftigen Oberflächen-Satiriker des Amtsschimmels. Für ihn, den gelernten Altösterreicher, ist das Amtswesen wirklich ein Wesen, eine geheimnisträchtige, nahezu okkulte Erscheinung innerhalb der Welt des Scheins, und er wird nicht müde, den unendlichen Abstufungen und Verästelungen dieses Wesens nachzuspüren: bis sie unter seiner Hand ein groteskes Eigenleben gewinnen und bis der Widersinn, ja der Unsinn einer allzu vordergründig eingerichteten Welt sich plötzlich im ernstgenommenen Nebensatz irgendeiner bürokratischen Verordnung spiegelt, bricht und zersetzt. Die Literatur kennt für solche Art der Weltbetrachtung ein einziges Gegenstück, welches desgleichen — und man möchte fast sagen: natürlich — dem Humus des alten Oesterreich entwachsen ist: Jaroslav Haseks geniale Geschichte vom „Braven Soldaten Schwejk“.
Zwischen diesen beiden, zwischen Nestroy und Haüek, steht Herzmanovsky, und steht nicht eigentlich, sondern schwebt — schwebt eine verwirrende Handbreite über dem Boden der Realität — schwebt einher wie die zierlich barocke, jedoch von ernsten Tschinellenklängen untermalte Melodie, die in seinem „Gaulschreck im Rosennetz“ dem Leibstuhl der Witwe Schosulan entklingt (einer ehemaligen Kammerfrau Maria Theresias, von der sie das kostbare Stück geerbt hat) — schwebt durch den Raum, und in seinem Raum ist Oesterreich.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!