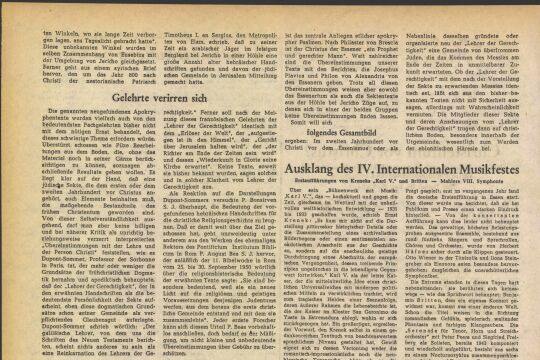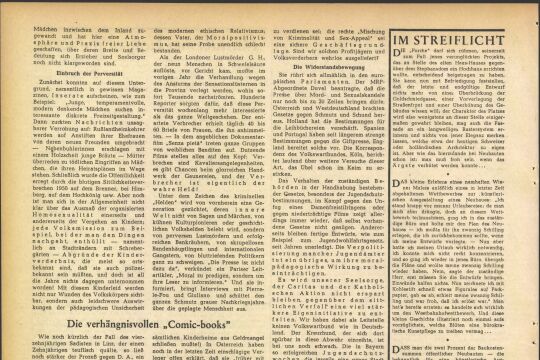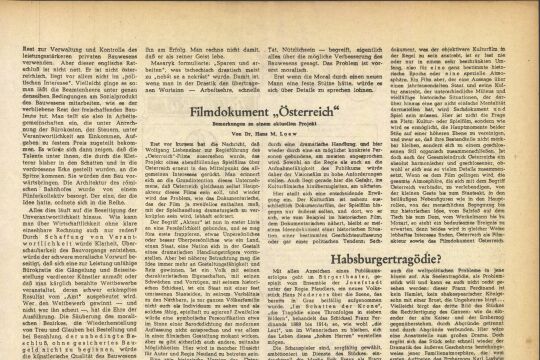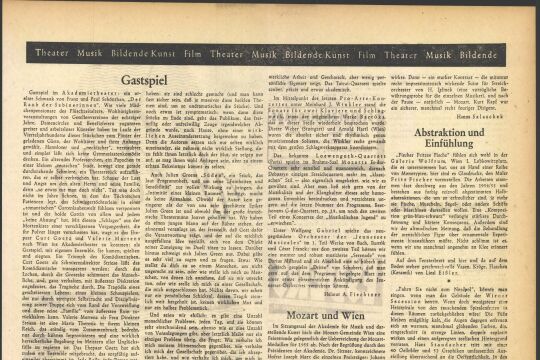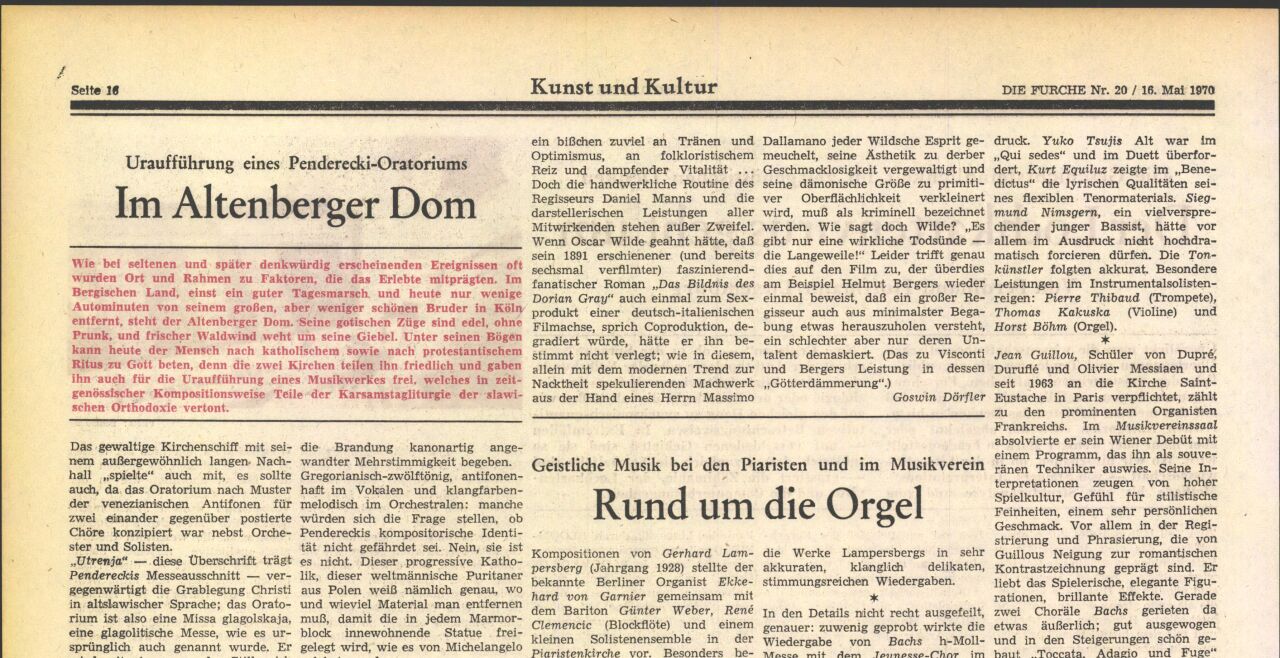
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Im Altenberger Dom
Wie bei seltenen und später denkwürdig erscheinenden Ereignissen oft wurden Ort und Rahmen zu Faktoren, die das Erlebte mitprägten. Im Bergischen Land, einst ein guter Tagesmarsch, und heute nur wenige Autominuten von seinem großen, aber weniger schönen Bruder in Köln entfernt, steht der Altenberger Dom. Seine gotischen Züge sind edel, ohne Prunk, und frischer Waldwind weht um seine Giebel. Unter seinen Bögen kann heute der Mensch nach katholischem sowie nach protestantischem Ritus zu Gott beten, denn die zwei Kirchen teilen, ihn friedlich und gaben ihn auch für die Uraufführung eines Musikwerkes frei, welches in zeitgenössischer Kompositionsweise Teile der Karsamstagliturgie der slawischen Orthodoxie vertont.
Das gewaltige Kirchenschiff mit seinem außergewöhnlich langen- Nachhall „spielte“ auch mit, es sollte auch, da das Oratorium nach Muster der venezianischen Antifonen für zwei einander gegenüber postierte Chöre konzipiert war nebst Orchester und Solisten.
„Utrenja“ — diese Überschrift trägt Pendereckls Messeausschnitt — vergegenwärtigt die Grablegung Christi in altslawischer Sprache; das Oratorium ist also eine Missa glagolskaja, eine glagolitische Messe, wie es ursprünglich auch genannt wurde. Er wird mit einem aus der Stille sich anhebenden Summton des einen Chores eröffnet, der sich stets steigert; es gesellen sich zum Baß auch die höheren drei Stimmgruppen mit einer nur im Bereich der halben und höchstens ganzen Tönen bewegten Homophonie, die durch raffinierte Stimmführung im Vertikalen dode-kaphon und im Horizontalen gregorianisch anmutet. Der zweite Chor wird zugezogen, auch das Orchester läßt sich mit zuerst pianissimo angesetzten, verfremdeten Bläserklängen, später mit sturmböenartig anschwellenden Tutti-Wellen vernehmen. Der Instrumentationseffekt ist Penderecki nicht fremd: er setzt ihn mit der reichen Registrierung der großen Orgel an, vermeidet jedoch das Schwelgen in einem Klangmodell, sondern bietet stets weitere an, immer dort, wo die kunstvoll geführten Chöre die Meeresstille der Homophonie verlassen und sich in die Brandung kanonartig angewandter Mehrstimmigkeit begeben. Gregorianisch-zwölftönig, antifonen-haft im Vokalen und klangfarbenmelodisch im Orchestralen: manche würden sich die Frage stellen, ob Pendereckis kompositorische Identität nicht gefährdet sei. Nein, sie ist es nicht. Dieser progressive Katholik, dieser weltmännische Puritaner aus Polen weiß nämlich genau, wo und wieviel Material man entfernen muß, damit die in jedem Marmorblock innewohnende Statue freigelegt wird, wie es von Michelangelo gelehrt wurde.
Eine Einschränkung soll der Handhabung der Solostimmen gelten, die außer einigen effektvollen Passagen zu einer recht untergeordneten Rolle verurteilt zu sein schienen. Es sang ein namhaftes Solistenensemble: Stefania Woytowicz, Sopran, Krustina Szczepanska, Alt, Louis Devor, Tenor, und die Bassisten Bernard Ladysz und Boris Carmeli. Der Kölner und Hamburger Rundfunkchor (Leitung: Herbert Schernus beziehungsweise Helmut Franz) und das Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchester unter der Leitung von Andrzej Markowski stellten sich nach schwerer Probenarbeit dem Publikum und der aus aller Welt herbeigeeilten Musikkritik mit einem Werk, das, wie Pendereckis berühmt gewordene Lukaspassion, wieder auf Grund der mäzenatischen Initiative des Westdeutschen Rundfunks entstand und seinen Weg begann. Peter Csobadi ein bißchen zuviel an Tränen und Optimismus, an folkloristischem Reiz und dampfender Vitalität ... Doch die handwerkliche Routine des Regisseurs Daniel Manns und die darstellerischen Leistungen aller Mitwirkenden stehen außer Zweifel. Wenn Oscar Wilde geahnt hätte, daß sein 1891 erschienener (und bereits sechsmal verfilmter) faszinierendfanatischer Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ auch einmal zum Sexprodukt einer deutsch-italienischen Filmachse, sprich Coproduktion, degradiert würde, hätte er ihn bestimmt nicht verlegt; wie in diesem, allein mit dem modernen Trend zur Nacktheit spekulierenden Machwerk aus der Hand eines Herrn Massimo Dallamano jeder Wildsche Esprit gemeuchelt, seine Ästhetik zu derber Geschmacklosigkeit vergewaltigt und seine dämonische Größe zu primitiver Oberflächlichkeit verkleinert wird, muß als kriminell bezeichnet werden. Wie sagt doch Wilde? „Es gibt nur eine wirkliche Todsünde — die Langeweile!“ Leider trifft genau dies auf den Film zu, der überdies am Beispiel Helmut Bergers wieder einmal beweist, daß ein großer Regisseur auch aus minimalster Begabung etwas herauszuholen versteht, ein schlechter aber nur deren Un-talent demaskiert. (Das zu Visconti und Bergers Leistung in dessen „Götterdämmerung“.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!