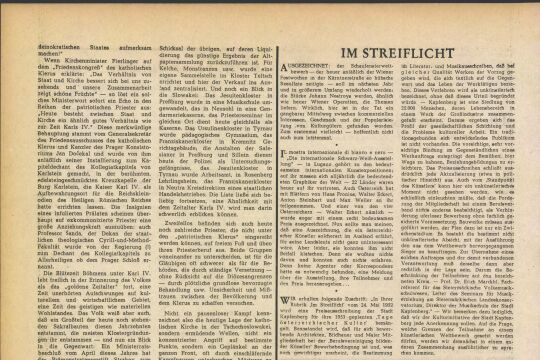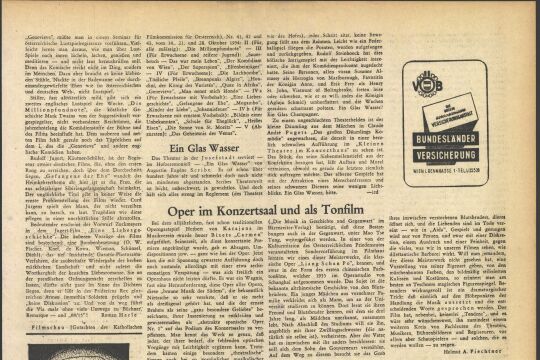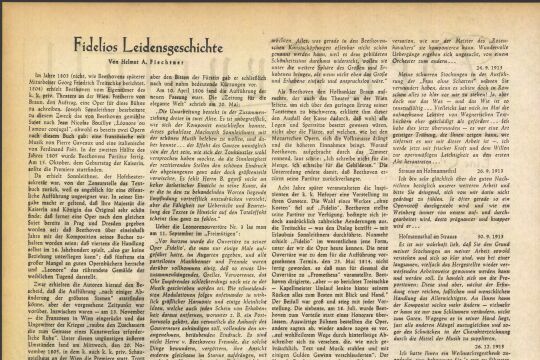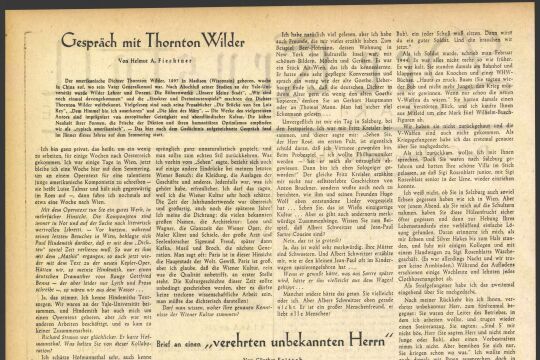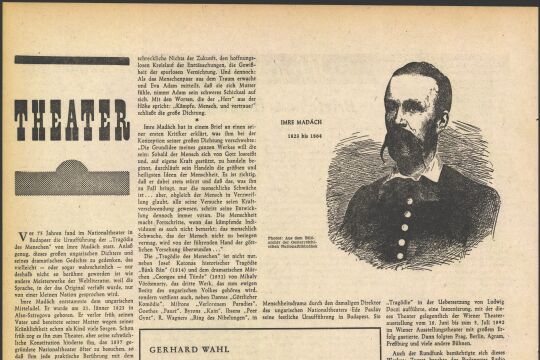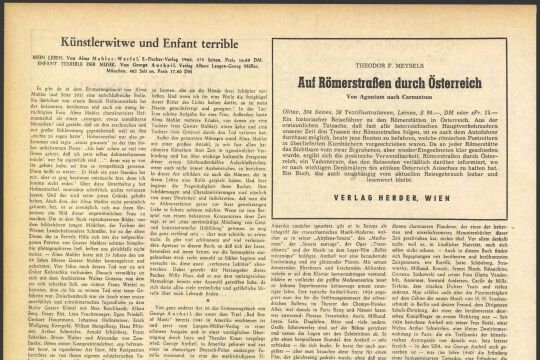Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Ein Denkmal des Expressionismus
Mit der Aufführung der dreiakti- gen Oper „Orpheus und Eurydike” von Ernst Krenek nach der Dichtung Oskar Kokoschkas durch die Wiener Konzerthausgesellschaft und den österreichischen Rundfunk wurde an ein Werk erinnert, das in der Geschichte des Expressionismus einen „Stellenwert” besitzt. Im Herbst 1915 hat der schwerverwundete Maler und Dichter, wie er später schrieb, „in Ekstase, im Delirium, heulend in Angst und Fieber der Tödesnähe”, heimgesucht von Visionen, die er auch in zahlreichen graphischen Blättern festgehalten hat, dieses merkwürdige Stück konzipiert, das in den Jahren 1917/18 seine endgültige Form erhielt.
Nicht nur die Symbolik der Handlung, sondern auch ihr einfacher Verlauf ist selbst nach wiederholter Lektüre kaum genau zu erfassen und wiederzugeben. Kokoschka hat den antiken Mythus sehr frei interpretiert und modernisiert. Zugleich sind in die Hauptaktion Amor und Psyche eingeblendet, in deren Verhältnis die höhere, geistige Liebe symbolisiert ist, während die Liebe zwischen Orpheus und Eurydike sowohl am Glücksegoismus des Mannes wie an der unlöslichen Bindung der Frau an den Hades und die chthonischen Mächte scheitert. Die Inschrift eines goldenen Ringes, der im 2. Akt eine Rolle spielt, heißt „Alios Makar”, zu Deutsch „Glück ist anders”. In ihr sind anagramma- tisch die Namen Oskar und Alma (Mahler) verborgen, was darauf hinweist, daß Kokoschkas Stück auch autobiographische Elemente enthält.
Ernst Krenek, der bereits zwei Opernversuche hinter sich hatte („Die Zwingburg” und „Der Sprung über den Schatten”), erhielt 1923 davon Kenntnis, daß Kokoschka sein Orpheus-Drama in eine Oper verwandelt zu sehen wünschte. Obwohl auch ihm das Buch auf weite Strek- ken unverständlich war, begann er mit der Niederschrift der Partitur, die „in fieberhaftem Tempo, wie in einem Traum” erfolgte, mehr seinem Instinkt als seinem Intellekt vertrauend — ein erstaunliches Zeugnis gerade aus der Feder dieses Musikers, der einige Jahre später die alle modischen Elemente der Zeit geschockt mixende Erfolgsoper „Jonny spielt auf” schrieb.
Die Uraufführung der Oper „Orpheus und Eurydike” fand 1926 in Kassel unter der Direktion von Paul Bėkker statt, dessen Assistent Krenek damals war. Seither hat sich keine Bühne mehr an das in jeder Hinsicht schwierige Werk gewagt. Die mit großem Aufwand realisierte Wiener Erstaufführung während der vergangenen Woche unter der Leitung des Komponisten hob ein völlig vergessenes Dokument des Expressionismus ans Licht — aber ob sie der Anfang einer Renaissance dieses Werkes, das heißt seiner Aufnahme in den Spielplan einiger größerer Bühnen sein wird, ist mehr als zweifelhaft.
Von den Schwierigkeiten des ver- worren-enigmatischen Textes haben wir gesprochen. Die Musik Kreneks ist nicht dazu angetan, diese zu mildem oder vergessen zu machen. Die Partitur stammt aus Kreneks freitonaler, genau gesagt: atonaler Periode, der bald eine neoklassizistische und eine romantische folgen sollte; der Zwölftonteehmdk bediente sich Krenek erst seit etwa 1932. Harmonisch gesetzlos, formal frei, sollte die Musik wenigstens emotionell dem Text folgen oder ihn steigern. Sicher hat sie für den Komponisten Beziehungen und Affinitäten zum Sujet und seinen einzelnen Phasen, wohl auch zu den Personen der Handlung. Aber der Hörer vermag weder mit der „Dichtung” Kokoschkas noch mit der Musik Kreneks viel anzufangen. Die Bewunderung des technischen Könnens allein, mit dessen Hilfe hier mehr als zwei Stunden lang Musik gemacht wird, genügt leider nicht, die Zeit zu füllen, geschweige denn zu erfüllen. — Daran konnte auch der löbliche Einsatz der drei Protagonisten (Ivo Zi- dek — Orpheus, Gerda Scheyrer — Eurydike, Laurence Dutoit — Psyche), sieben weiterer Solisten sowie des Chores und des Orchesters von Radio Wien nichts ändern. Der Autor des Bühneniwerkes und der Komponist haben ihr Persönlichstes gegeben, beider Kunstgesinnung steht außer Frage. Die Ausführenden haben sich angestrengt, das Publikum hat’s an gutem Willen nicht fehlen lassen. Daß trotzdem „etwas fehlte”, wie es bei Brecht heißt, konnte niemandem, der Ohren hat zu hören, verborgen bleiben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!